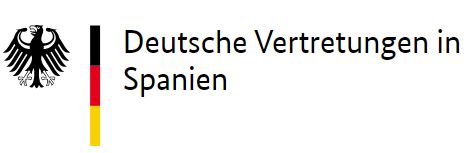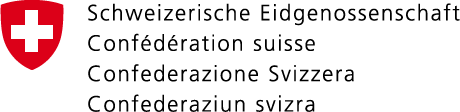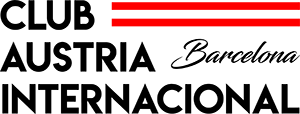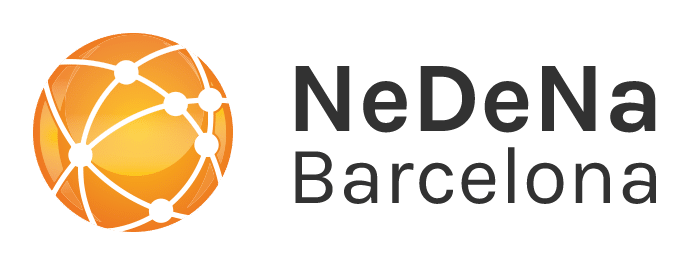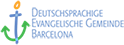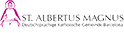Jeder sollte sein Apfelbäumchen pflanzen
 Interview mit Helke Sander, Regisseurin, Professorin und Autorin
Interview mit Helke Sander, Regisseurin, Professorin und Autorin
Helke Sander war im Herbst letzten Jahres zum Frauenfilmfestival „Mostra Internacional de films de Dones“ in Barcelona eingeladen. Ich treffe sie an einem sehr sonnigen Tag im Romanischen Café in Berlin Charlottenburg, das in den 20er Jahren ein wichtiger Künstlertreffpunkt war.
Frau Sander, Sie sind Regisseurin, Autorin, Professorin an der Uni – ich bin beeindruckt von der Vielfältigkeit Ihrer Tätigkeiten. Was ist Ihr wichtigstes Anliegen?
Ich wollte immer Regisseurin werden. Und das bin ich dann auch geworden. Aber um das zu werden, musste man gerade damals – ich habe schon einige Jahre „auf dem Buckel“ – viele Hürden überwinden. Abgesehen davon, dass ich auch ein Kind hatte, für das ich alleine sorgte. Das war damals besonders kompliziert, insbesondere da ich keine anderen Geldquellen hatte. Daher musste ich notgedrungen auf vielen Hochzeiten tanzen. Und mich auch politisch darum kümmern, als Frau in dieser Branche Fuß zu fassen.
Woher kam Ihr Wunsch Regisseurin zu werden?
Ich wollte zunächst Schauspielerin werden, habe unglaublich viel Theater gesehen und lange am Theater in Finnland gearbeitet. Das hat mir oft nicht gefallen und ich dachte: das kann ich besser!
Auf dem Barceloneser Frauenfilmfestival „Mostra de Films de Dones“ in Barcelona haben Sie Ihren Dokumentarfilm „BeFreier und Befreite. Krieg, Vergewaltigungen, Kinder” zu den Vergewaltigungen im Frühjahr 1945 gezeigt. Wie sind Sie zu diesem Thema gekommen und was hat die Arbeit an dem Thema bei Ihnen bewirkt?
Um das Letzte vorweg zu nehmen, ich kann mir keine Filme mehr angucken, in denen Gewalt ausgeübt wird. All die Jahre, in denen ich für den Film recherchierte, habe ich Furchtbares gesehen. In der Zeit hatte ich mir ein Verhalten angelegt, wie es Kriminalisten haben, wenn sie Morde untersuchen. Die müssen alles abspalten, um das angucken zu können. Und das konnte ich auch. Aber als die Arbeit am Film dann fertig war und die Anspannung nachließ, da fiel es mir immer schwerer und heute kann ich es gar nicht mehr.
Ich war gewissermaßen in den letzten Kriegstagen Zeugin und hab diese Zeit noch miterlebt. Danach kam das Thema in verschiedenen Wellen wieder auf mich zu. Ich habe viel über Geschichte, vor allem Berliner Nachkriegsgeschichte gelesen. Dort tauchte der ungenaue Hinweis auf die Massenvergewaltigungen immer wieder auf. 1972 fing ich an mich damit zu befassen. Gleichzeitig gab es in Amerika die Frauenbewegung, die sich mit aktuellen Vergewaltigungen befasste. Ich war fast ein bisschen hochnäsig und dachte mir: was versteht ihr schon davon. Diese Haltung habe ich später korrigiert, aber es hat mich dazu bewogen, mich näher mit dem Thema zu befassen.
Ich hatte große Hemmungen, weil ich auf gar keinen Fall in das Klischee „die bösen Russen und die guten Anderen“ fallen wollte. Es hat ein Weilchen gedauert, bevor ich wusste, wie ich an die Sache rangehen sollte. Ich habe sehr lange recherchiert. Das Problem war nicht, Frauen zu finden, die vergewaltigt wor-den waren. Mich interessierte vielmehr, was mit dem Ausdruck Massenver-gewaltigung gemeint war. Waren es 100, 10.000 oder 100.000? Denn wenn es wirklich so viele waren, war es verwun-derlich, dass sich die Politik nicht damit befasst hat.
Für die Fragestellung habe ich in vielen internationalen Archiven recherchiert, die das Stichwort Vergewaltigung noch nicht führten. Das gab’s erst, nachdem ich wieder weg war, weil ich auf den Eintrag bestand. Die Historikerin Barbara Johr und der Statistiker Dr. Reichling, der sowohl im Osten als auch im Westen für die Vertreibungsgeschichte anerkannt war, unterstützten mich. Bis zu einem gewissen Punkt kann man heute beweisen, dass die Mindestzahl einer „Masse“ erreicht wurde. In Berlin wurden mindestens 100.000 Frauen in kürzester Zeit vergewaltigt. In Gesamtdeutschland ca. 2 Millionen, fast ein Zehntel der damaligen Frauenbevölkerung. Innerhalb eines knappen Jahres.
Wie erklären Sie sich dann, dass die Politik nicht darauf reagierte?
Am Anfang des kalten Krieges hatten die westlichen Truppen kein Interesse daran, auf einer Linie mit den östlichen zu ste-hen. Die Amerikaner haben ebenfalls vergewaltigt, aber das sollte nicht hoch-kommen. Die deutschen Kommunisten wollten das auch nicht. Nach dem Krieg dachten sie, dass sie die ersten Nach-kriegswahlen gewinnen könnten. Das ist ihnen aber nicht gelungen. Daher rührt das Sprichwort: „die deutschen Frauen haben sich gegen ihre russischen Lieb-haber entschieden“. Wobei Liebhaber euphemistisch ist.
Zurzeit ist Deutschland stark in der Kritik im Ausland – wie beurteilen Sie als Kulturschaffende, die Wahrnehmung der deutschen Kultur im Ausland?
Das kann ich im Augenblick nicht beurteilen, da ich weniger reise. Ich konzentriere mich auf mein neues Buch.
Fühlten Sie sich bei dem Filmfestival in Barcelona als Deutsche?
Bei den Frauenfilmfestivals ist man froh unter Gleichgesinnten zu sein. Das Ganze ist aus einer Protesthaltung entstanden, da man Themen anspricht, die im Mainstream vernachlässigt werden. Da entstehen solidarische Gefühle. Filme-macherinnen, die sich dafür eingesetzt haben, dass Filme von Frauen gezeigt werden, meiden den Ausdruck „Frauen-film“. Das fanden wir immer scheußlich. Wir sagten auch nicht „Männerfilme“.
Würden Sie sagen, dass Frauen sich im Filmgeschäft etabliert haben?
Zum Teil ja, aber zum großen Teil auch nicht. Wie es sich aus der Diskussion um die Quote ergibt, sind Frauen im Kinobereich weiter in der Minderheit. Vor allem im Mainstream haben Frauen es sehr schwer.
Sie unterstützen den Verein Pro Quote Regie, der mehr Transparenz und Gleichberechtigung der Filmförderung fordert. Stoßen Sie auf viel Kritik?
Die Hälfte allein bringt nichts, wenn es Blödsinn ist. Ich unterstütze die Quote, wenn sie inhaltlich gefüllt ist. Als die Schwarzen in Südafrika das Wahlrecht bekamen, wusste man nicht, wie die Einzelnen wählen. Trotzdem waren wir dafür. Und so ähnlich ist das hier auch. Es gibt Frauen, die den gleichen Mist wie manche Männer machen. Aber ist es richtig, dass diese unglaublichen Ungerechtigkeiten abgeschafft werden. Ich kümmere mich derzeit nicht so viel darum, weil ich keine Filme mehr mache, sondern schreibe. Deswegen denke ich, sollen das jetzt mal die Jüngeren machen.
In Ihrer berühmten Rede vor dem Sozialistischen Deutschen Studenten-bund 1968 erklären Sie das Private für politisch. Wie sehen Sie die Lage der Gesellschaft in puncto Geschlechter-gerechtigkeit heute?
Ich habe mich immer sehr damit beschäftigt, woher die Frauenunterdrückung kommt, weil es sie im Tierreich nicht gibt. Selbst die sogenannten dominanten Männchen sind letztlich nicht so dominant. Das ist sehr interpretationsfähig. Heutzutage werden Frauen in dem Augenblick, in dem sie ein Kind bekommen, in vielerlei Hinsicht benachteiligt. Die Gesellschaft ist nicht darauf ausgerichtet, dass Frauen mit Kindern sich entfalten und die Geschicke ihrer Gesellschaft mitbestimmen können, sondern sie wirken vor dem Hintergrund dessen, was sich durchgesetzt hat, und das ist nicht von Frauen mitbestimmt. Der Kern der Rede war damals, dass Politik auf neue Grundlagen gestellt werden und nicht nur von Männern in politischen Männerorganisationen vorgegeben werden sollte.
Sollten Frauen erst nach den (männlichen) Spielregeln mitspielen (z.B. Leistungsprinzip), um dann von oben die Spielregeln zu ändern?
Das ist mir zu bürokratisch! In gewissen Formen verhalten sich alle so oder müs-sen das auch, weil man nicht plötzlich aus dem Nichts etwas Anderes machen kann. Die Leute sind so unterschiedlich und haben unterschiedliche Probleme. Wenn man zum Beispiel nicht weiß, wovon man die Miete im nächsten Monat bezahlen soll, dann kommt man nicht auf solche Gedanken.
Würden Sie sagen, Gleichberechtigung ist ein Luxusproblem?
Nein, gar nicht. Gleichberechtigung ist etwas anderes als Emanzipation. Gleichberechtigung heißt zum Beispiel auch: Frauen gehen zur Bundeswehr. Ich war auch dagegen. Bei bestimmten Sachen mussten Frauen bisher nicht mitmachen, was eine gewisse Freiheit des Denkens erlaubte. Diese Möglichkeit wird immer unwahrscheinlicher, wenn Frauen überall dort mitmachen, was Männern Ruhm und Ehre bringt. Die Kritikfähigkeit war vorher größer.
Was möchten Sie der postfeministischen Generation mitgeben, die meint, dass Gleichberechtigung erreicht ist und Feminismus als übertrieben kritisch abtut?
Zunächst muss man sagen, dass der Feminismus von Anfang an unglaublich vielfältig und heterogen interpretiert wurde. 1968 galt noch „kein Feminismus ohne Sozialismus“. Gemeint war nicht der Sozialismus der DDR, sondern eine neue, gesellschaftliche Vorstellung. Wir versuchten alles zu besprechen und z. B. neue Wohnformen zu entwickeln. Feministinnen nannten sich jedoch auch die Frauen, die sich für Pinochet engagierten. Dann gab es Feministinnen, die sich direkt gegen Männer richteten. Es ist wichtig zu wissen, worüber man spricht. Wenn ich über Feminismus spreche, dann meine ich im Grunde genommen, dass alle Fragen, die die gesamte Gesellschaft betreffen, sich auch von Frauen mit Kindern her entfalten müssen. Das was kritisiert wird, sind oft kurzfristige Themen, die gerade in der Presse hochkommen. Ich denke, Frauen sollten heutzutage durchaus selbstbewusst sein und sich nicht von den Vorkämpferinnen absetzen wollen. Das haben wir auch gemacht. Wir wollten nichts mit den Suffragetten zu tun haben, weil wir sie als hysterische Frauen sahen, die mit Regenschirmen andere verprügelten. Als wir ihre Schriften lasen, hat das unseren Eindruck stark verändert. In Amerika ist es beispielsweise nicht so ausgeprägt wie hier, dass alle erfolgreichen Frauen sich erst einmal vom Feminismus distanzieren. Das finde ich beschämend. Aber ich denke, dass es heute für junge Frauen schwer ist und dass man neue Strategien entwickeln muss.
Wie könnten diese Strategien aussehen?
Es gibt große Unterschiede. Früher wussten wir wenig über vorherige Frauenbewegungen, weil uns das in der Schule nicht beigebracht wurde. Wir wussten wenig über Frauen in anderen Ländern. Das ist jetzt viel bekannter, weil die Welt globalisierter geworden ist. Diese Unterschiede – der Mädchen- und Frauenhandel hat unglaublich zugenommen, vielen Frauen geht es viel schlechter als früher und sie sind viel ärmer – sind sehr groß. Es sind die gutausgebildeten Frauen in den westlichen Staaten, die Reden über Emanzipation führen könnten.
Haben Sie trotz dieser Lage Hoffnung für das, was der Feminismus eigentlich erreichen möchte?
Ich bin da inzwischen eher skeptisch.
Lohnt es sich denn dann überhaupt?
Man muss – obwohl ich nicht christlich bin – wie Luther schon sagte: auch wenn man wüsste, dass morgen die Welt untergeht, heute noch sein Apfelbäumchen pflanzen.
Das ist ein gutes Schlusswort. Frau Sander, ich bedanke mich herzlich für das sehr anregende Gespräch.
Von Alma Laiadhi, Ende März 2015, Berlin
Schlagwörter: Biografisches, Geschichte, Interviews, Kultur

 Share On Facebook
Share On Facebook Tweet It
Tweet It