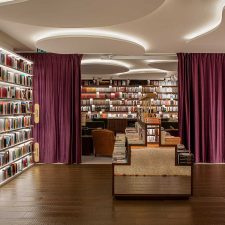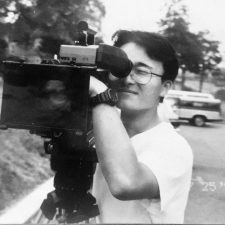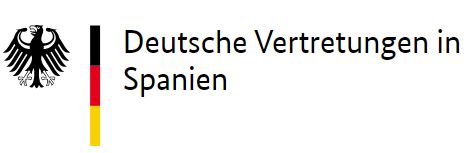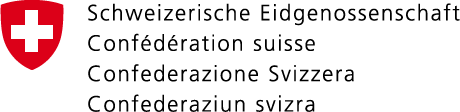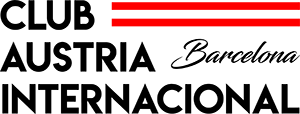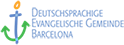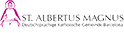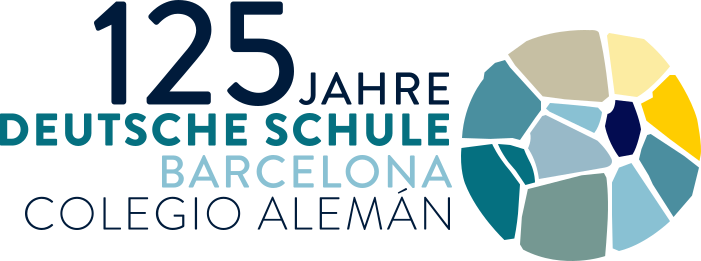Gehören Anglizismen zur deutschen Sprache?

Englische Worte werden heute gerne im Deutschen eingesetzt
Die Sprache dient der Kommunikation innerhalb ei-ner Gemeinschaft und erzeugt und bewirkt Bewe-gung durch Inhalt und Aussagekraft ihrer Worte. Die Sprache eines Landes bewegt sich in vielfältigen Kon-taktfeldern, kommt mit Mundarten und Sprachen anderer Gesellschaften in Berührung und befindet sich in stetigem Wandel. In einer Sprache zeugen u.a. Dialekte, Regiolekte und Soziolekte von kontinuierli-chen Fremd¬einflüssen und der damit verbundenen Diversität der Gesellschaft. Diese verändert sich mit der Zeit ebenso wie ihre Sprache.
Galten im Altertum Griechisch und Latein als europäische Kulturträger, übernahm das Lateinische im Mittelalter die Rolle der lingua franca und wurde – vornehmlich zum Studi-um der Heiligen Schrift – in kirchlichen Einrichtungen und christlichen Klöstern gelehrt und geschrieben. Das im 16. Jahrhundert aus vielen regionalen Dialekten bestehende Deutsche wurde erst durch Martin Luther vereinheitlicht, der dem „Volk aufs Maul geschaut“ und die deutschen Regi-onalsprachen berücksichtigt hatte, um seine Bibelüberset-zung allen Deutschsprachlern verständlich zu machen. Im 17. Jahrhundert hingegen wurde das Deutsche von Friedrich II. (dem Großen) schlichtweg als „Sprache für Pferdekutscher“ missbilligt. Der gebildete Preußenkönig korrespondierte und parlierte am liebsten mit dem französischen Philosophen Voltaire in dessen Landessprache. Die Französische Revoluti-on und die napoleonische Besetzung Europas bestärkten diese Spracheinstellung. Französisch avancierte rasch zur Sprache der Aristokratie und galt jahrhundertelang als Kom-munikationsinstrument der Diplomatie. Zahlreiche ins Deut-sche eingegangene französische Wörter (Portemonnaie, Journalist, Feuilleton, Garage, Blamage, Gage, Bandage, etc.) zeugen von der damaligen Dominanz der eleganten französi-schen Sprache. Das deutsche Bildungsbürgertum sprach oftmals Französisch, wie im ersten Teil von Thomas Manns „Buddenbrooks“ offenbart wird.
Unbestreitbarer Fakt ist heutzutage, dass – in der technologi-schen, digitalisierten Aktualität – Englisch zur weltweiten Kommunikationssprache aufgestiegen ist, zumal sich dieses durch eine relativ leicht zu erlernende Grammatik und einen beträchtlichen Reichtum an knappem Vokabular auszeichnet. Der Gebrauch von Anglizismen im Deutschen hat jedoch in den letzten Jahrzehnten unverhältnismäßig zugenommen. Es stellt sich die Frage, welche Anglizismen im deutschen Sprachgebrauch notwendig und welche überflüssig sind. Zum angesprochenen Thema äußerte jemand aus dem Freundes-kreis, zurzeit gebe es über Wichtigeres zu diskutieren. Den-noch halte ich es für hochaktuell. Ist es denn nicht offensicht-lich, dass Anglizismen in rasanter Geschwindigkeit nicht nur die deutsche Sprache unterwandern, sondern sich zu ver-breiten scheinen wie eine unheilbare Krankheit?
Die Corona-Pandemie, die seit Anfang 2020 die Welt fest im Griff hält, zwingt die Länderregierungen je nach Verbrei-tungsgeschwindigkeit, einen harten Shutdown oder Lock-down zu verhängen. Unzählige Arbeitnehmer arbeiten seit-dem im Homeoffice und beaufsichtigen derweil ihre schul-pflichtigen kids, deren Lehrer ihnen am Computer, Tablet oder Laptop Heimunterricht – sogenanntes Homeschooling – erteilen. Zur raschen Weiterleitung von Messages ist eh ein High-Speed-Internet erforderlich Die Gesundheitsbehörden melden steigende Infektionszahlen aus den Hotspots, wo Spreader ihre Mitmenschen mit dem Virus infizieren. Die rettende Impfung sei ein Game-Changer, so kürzlich ein Fernsehsprecher.
Der Kanzlerin Merkel, die per Live-Stream bei Konferenzen in Fernsehprogrammen zu sehen oder im Podcast zu hören ist, wird hinsichtlich ihrer Kanzlerschaft bescheinigt, sie sei kein typisches Role-Model.
Bin ich Berufseinsteiger*in oder will ich als Start-up ein Un-ternehmen gründen, ist ein praktikabler Business-Plan von-nöten, selbst wenn ich als Key-Account oder Sales Manager über weitreichende Wirtschaftskenntnisse verfüge. Deshalb habe ich mir ein Buch – mit Hardcover versteht sich – über Business Management zugelegt. Zuvor habe ich Flyer verteilt, auf denen ich mein erstes Business Meeting als Happening bzw. spannendes Event ankündige. Auf meiner Website habe ich bereits ein Update gemacht, eine Flatrate beantragt und einschlägige Dokumente downgeloadet. Dann war ich in der City shoppen, um mein Outfit zu stylen und habe mich verge-wissert, dass auf meinem Twitter-Account die Zahl meiner Follower auf 2.220 gestiegen ist. Wow, meine Outdoor-Jacke sieht echt cool aus und passt zu meinem new Casual-Wear. Zur Einweihung meines E-Commerce-Business werden übri-gens keine Fastfood-, sondern kleine Fingerfood-Häppchen gereicht.
Dies sei lediglich ein knapper „Imbiss“ des oftmals schwer-verdaulichen Sprachgemisches, das uns täglich aus den Me-dien oder in Gesprächen aufgetischt wird. Vom Coffee to go zum Mitnehmen ganz zu schweigen.
Unaufhaltsam wächst die Liste der Anglizismen im Deutschen. Oft verfehlen die übernommenen englischen Begriffe ihre Bedeutung: Im Homeoffice arbeiten hieße nach britischem Verständnis im „Innenministerium“ für Verbrechen, Drogen-handel und Terrorismus zuständig zu sein. Absurd, oder? Es sollte überlegt werden, ob nicht ein modern klingender Ang-lizismus ein deutsches Äquivalent hat. Das jiddische blitspost (E-mail) wäre das Paradebeispiel einer möglichen Überset-zung. Die dazu nötige Phantasie ist uns allerdings abhanden gekommen.
Wird die unerschöpfliche Vielfalt an Wortkombinationen – ein Erkennungsmerkmal der deutschen Sprache – allmählich zugrunde gehen? Wäre es letztlich nicht identischer, statt Happy Birthday das vertraute Lied „Zum Geburtstag viel Glück“ anzustimmen. Übrigens bin ich nicht happy, sondern glücklich, dass ich gesund bin und hoffentlich bleibe!!
Von Dr. phil. Evelyn Patz Sievers, Februar 2021
Schlagwörter: Kultur

 Share On Facebook
Share On Facebook Tweet It
Tweet It