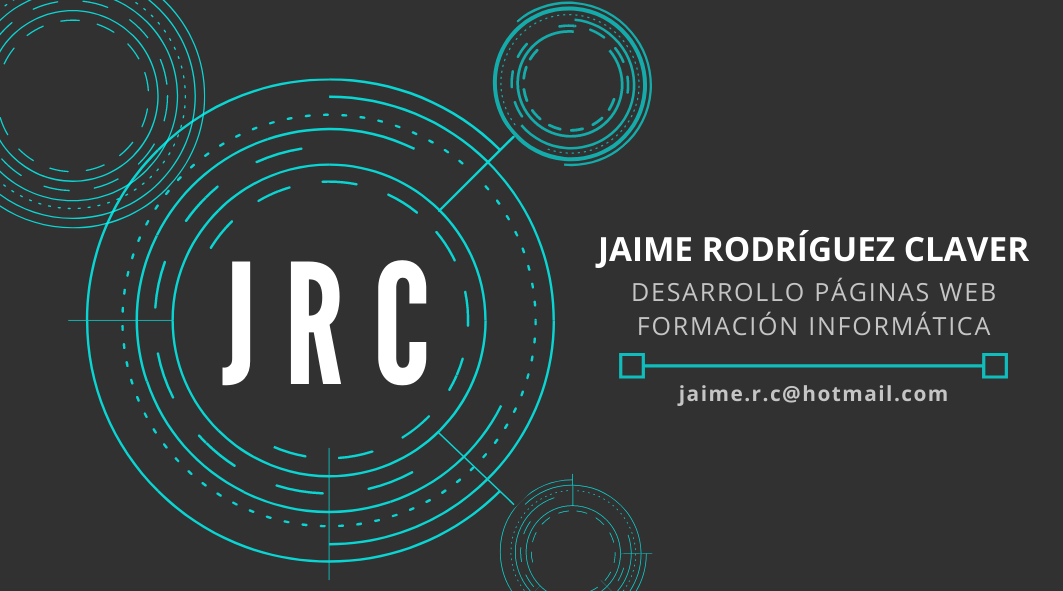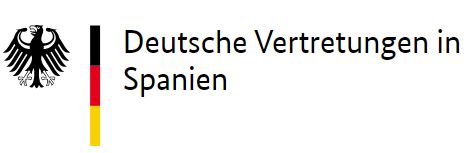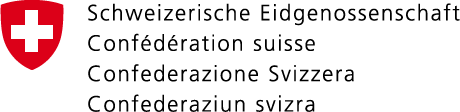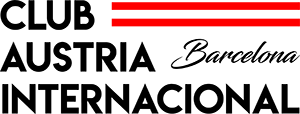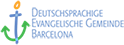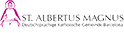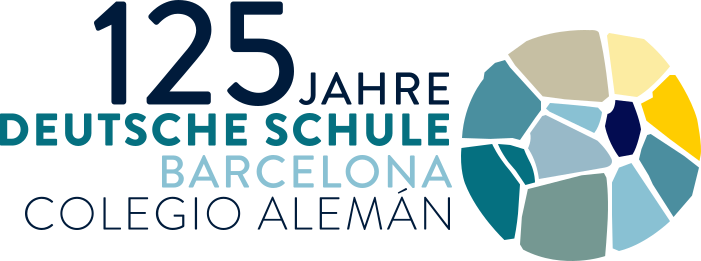Gesundes Europa

Ulla Schmidt nahm im November an einer Debatte zu Kultur und Konflikt im Goethe Institut Barcelona teil.
Interview mit Ulla Schmidt, SPD-Politikerin, ehemalige Gesundheitsministerin und Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages
Ende November treffe ich Ulla Schmidt zum Interview im Goethe-Institut in Barcelona, wo sie am De-batten-Zyklus „Europa denkt“ mit dem ehemaligen Institutsleiter Ronald Grätz und Alfons Martinez, emeritierter Dozent der Universität Girona und Experte in Kultur und Entwicklung teilnimmt.
Sie nehmen heute an einem Debatten-zyklus „Europa denkt“ im Goethe Institut Barcelona teil. Denken Sie, dass Europa denkt?
Davon bin ich überzeugt. Ob es immer in die richtige Richtung denkt, ist eine andere Frage. Aber ich glaube, dass Europa für mich das große Friedensprojekt ist. Ich bin so alt wie die Bundesrepublik und deshalb aufgewachsen mit vielen Fragen der europäischen Annäherung. Europa steht jetzt vor großen Herausforderungen, sowohl innerhalb als auch geopolitisch bedingt, aber natürlich auch durch die anstehende Entwicklung in den Vereinigten Staaten mit dem neuen Präsidenten, der gegen die transatlantischen Beziehungen ist. Für die Westbindung Europas, die Einheit Europas hat es schon bessere Zeiten gegeben auch mit starken Persönlichkeiten, die die euro-päische Idee vertreten.
In den verschiedenen Etappen Ihres Le-bens waren Sie u.a. als Lehrerin für Son-derpädagogik, Politikerin, Abgeordnete, Gesundheitsministerien tätig. Welche Etappe hat Sie am stärksten geprägt?
Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Ich bin unheimlich gerne Lehrerin gewesen, aber noch lieber bin ich Abgeordnete, weil man da vieles erleben kann. Das Gesundheitsministerium war eine große Heraus-orderung, wo man täglich vor neuen Problemen stand. Die eigentlich schönste Zeit war die Zeit der Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, weil ich sehr viele auch internationale Kontakte pflegen konnte und mit den anderen Parlamenten zur Frage zusammentraf, wie funktioniert die Demokratie. Deutschland kommt in einer Großen Koalition zusammen, was in anderen Ländern undenkbar ist (sie lacht). Bei uns merkt man momentan wie schwierig es ist, eine Minderheitenregierung aufzustellen. Das sind neue Erfahrungen. Es war interessant auch im Sinne der Frage, wie die Demokratie Kompromiss lebt, inter-fraktionell arbeiten und versuchen muss, alles zu irgendeiner Einigung zu bringen.
Welche Bilanz ziehen Sie heute, was die Inklusion anbelangt?
Wir sind schon weit vorangekommen. In der Frage der Gleichstellung von Menschen mit Behinderung ist es überall etwas anders, wenn man die europäischen Länder betrachtet. Deutschland hatte eine Geschichte, die wir überwinden wollen, um sich von diesem negativen Blick auf Menschen mit Behinderung abzuwenden, die im Nationalsozialismus brutal ermordet oder zwangssterilisiert wurden. Es hat lange Jahre gedauert, um diesen Blick zu ändern, vielleicht auch die Fähigkeit, auf die Defizite zu lenken. Wir sind heute noch ganz weit von wirklicher Inklusion entfernt, wie wir sie im Grundgesetz ratifiziert haben, wie es deutsches geltendes Recht ist. Eine inklusive Gesellschaft muss die Grundlage jeden gesetzlichen Handelns sein. Da sind wir noch nicht. Auch wenn man im Einzelnen Erfolge zeigen kann. Teilhabe als Menschenrecht zu betrachten ist schwer. Die rechtspopulistischen Strömungen in Europa prägen wieder ein Bild, das zurück-geht, weg von der Inklusion. Das macht Menschen mit Behinderung und ihren Eltern wieder Angst.
Wenn Sie heute Gesundheitsministerin wären, was wäre Ihr Hauptanliegen?
Im Moment wäre es für mich die Frage der finanziellen Stabilisierung unserer sozialen Sicherungssysteme. Bei den Krankenversicherungen ist einiges auf den Weg gekom-men, aber als besondere Herausforderung empfinde ich die Sicherung der Pflege durch die Pflegeversicherung in einer älter werdenden Gesellschaft. Die Leistungen werden auch deshalb stärker in Anspruch genommen, weil heute mehr Menschen nach schweren Krankheiten überleben, aber dauerhaft Unterstützung brauchen. Die qualitativ hochwertige Pflege im Alter oder bei Bedarf muss finanziell sichergestellt, damit Menschen keine Angst haben müssen, arm zu werden, wenn sie pflegebedürftig sind.
In einer aktuellen Dokumentation über Menschen mit Long- oder Post-Covid beklagen sich die betroffenen Familien auch über die mangelnde Unterstützung in der Pflege.
Wir haben bei Long-Covid zu wenig Ärzte und Ärztinnen und Behandlungen, die sich diesem neuen Phänomen gut annehmen können. In der Anlaufstelle an der Charité in Berlin müssen die Patienten monatelang warten, ehe sie Zugang zu einer spezialisierten Behandlung bekommen. Karl Lau-terbach hat bereits viel investiert, aber es braucht viel Zeit, da wir nicht genau wissen, was mit diesem Virus ausgelöst wurde. Da sind wir noch am Anfang.
Was denken Sie über die politische Krise in Deutschland?
Als Sozialdemokratin hoffe ich, dass wir bald über Inhalte diskutieren. Man muss um neue Mehrheiten ringen. Ich hatte mir von der Ampel-Koalition viel mehr erhofft. Der Koalitionsvertrag war sehr gut. Viel zu wenig von dem, was für Menschen mit Behinderungen drinsteht, ist umgesetzt worden. Natürlich war ein Grund dafür auch die internationale Krise. Es wird schwierig. Wir führen Kämpfe mit den populistischen und rechtspopulistischen Strömungen. Außerdem stehen wir vor großen wirtschaftspolitischen Herausforderungen. Die deutsche Wirtschaft ist nicht so, wie wir es uns gerne wünschen und wenn Deutschland krankt, dann krankt ganz Europa. Das ist eine unschöne Gemengelage.
In den 60ern gab es den Slogan „Nie wieder Krieg“. Ist er angesichts der Militarisierung Deutschlands heute noch gültig?
Ja! Ich bin eine, die in den 70er und 80er Jahren wegen des Nato-Doppelbeschlusses auf allen Friedensdemos gewesen ist. Ich muss erkennen, dass dieser Weg, von dem wir lange gedacht haben, dass er trägt, nicht mehr hält. Die Einigung Europas wird Kriege zwischen den europäischen Ländern verhindern. Ich habe mich mit der Nato angefreundet, nicht nur als Militärbündnis, sondern als politisches Bündnis zur Verteidigung gemeinsamer Werte. Leider ist es heute so, dass wir die Wiederbewaffnung und den Aufbau der Bundeswehr brau-chen, auch um als Nato-Verbündete ganz deutlich zu machen: wer uns angreift, der muss mit Reaktion rechnen. Zur Abschreckung und um Krieg zu verhindern, brauchen wir Waffen. Wir haben gesehen, dass Putin keine Rücksicht nimmt. Wo er glaubt, gewinnen zu können, geht er mit der brutalsten Gewalt rein. Es ist ein Vernichtungsfeldzug, den er gegen die Ukraine führt. Dagegen müssen wir uns wappnen. Keiner soll denken, er macht Halt, wenn er das kriegt, was er braucht.
Sie kennen die NATO sehr gut. Haben Sie wegen der Rückkehr von Trump Angst um die Nato?
Nein, eigentlich nicht. Ich glaube, dass die Nato sehr stark ist und dass auch Trump in der ersten Amtszeit nicht hat wahr machen können, was er prophezeit hat. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass es in der sogenannten „Grand old Party“ der Republikaner eine sehr tiefe Westbindung gibt und er in seinen eigenen Reihen große Schwierigkeiten bekommt. Mark Rutte sagt, dass man Trump so nehmen muss, wie er ist und weiter daran arbeiten, dass wir zusammenstehen. Wir werden sehen, ob die beschlossene Stationierung der Waffen in Westdeutschland noch stattfindet.
Heute gibt es einen Wettstreit zwischen der Friedenskultur und der Rüstungslobby. Glauben Sie, dass die Rüstungslobby gewonnen hat?
Nein, das glaube ich nicht. Eigentlich würde man sich heute wünschen die Rüstungsindustrie könnte schneller das produzieren, was wir brauchen. Wenn ich die Jahre in Deutschland passieren lasse, waren wir immer in dem Glauben, dass es keinen Angriffskrieg mehr gibt. Deshalb haben wir unsere Bundeswehr nur auf internationale Einsätze ausgebildet, aber nicht mehr für die eigene Verteidigung. Mit Boris Pistorius kommt etwas Ruhe in die Debatte. Es geht Schritt für Schritt nach vorne. Überraschend war für mich, dass man bei manchen Bestellungen von Waffensystemen Jahre warten muss. Die Produktion muss hochgefahren und Geld mobilisiert werden. Es ist eine Herausforderung für die demokratischen Staaten, denn das Geld muss erst verdient und demokratisch bestimmt werden, wie es in Krisensituationen ausgegeben wird. Wie kann man dem Klimawandel durch die Umstellung unserer Wirt-schaft begegnen? Wie bringt man die Inte-ressen für Digitalisierung und Militarisierung gegen Kriege zusammen. Wie schafft man es, dass nicht militärische Aufrüstung gegen soziale Sicherheit ausgespielt wird. Denn ohne soziale Sicherheit driftet ein Volk auseinander. Diese Perspektive wollen wir nicht. Vor diesen Fragen stehen alle europäischen Länder.
Welche Hilfsmittel bietet uns die Kultur in Konfliktsituationen?
Sie bietet die Möglichkeit des interkulturellen Dialogs und der Verständigung. Kultur ist nicht als solches Konflikt entschärfend. Im Sinne von Hannah Arendt, die uns alle beeinflusst hat, ist die Kultur über den Tag als universelles Menschenrecht zu sehen. So ist Kultur eine Perspektive. Kultur ist das, wie wir unsere Gesellschaft leben und im Rechtsstaat, wie wir miteinander umgehen. Kulturelle Identität ist in den europäi-schen Ländern unterschiedlich. Als Ministe-rin habe ich immer gesagt, zur deutschen kulturellen Identität gehört, dass Geburten im Krankenhaus stattfinden. Wenn man einem Krankenhaus die Geburtsstation nimmt, dann bekommen sie eine kulturelle Revolution. Sie ist auch Grundlage von Konflikten. Wir sehen heute rechtsextreme und populistische Kräfte, die versuchen kulturelle Identität als Waffe gegen eine Gesellschaft als Konfliktverschärfer einzusetzen.
Die Pegida Bewegung hat schon 2015 während der Flüchtlingswelle in Europa gegen eine Islamisierung gehetzt. Die AFD findet die Arbeit der Goethe-Institute sehr gut. „Goethe brauche man, weil ja eine „Umvolkung“ stattfindet und sie meint, dass „die Deutschen dann froh seien, wenn sie ir-gendwo noch Deutsch sprechen lernen“. Man kann es sich nicht vorstellen, dass ein intelligenter Mensch so etwas sagt, aber sie hetzen in der Art. Kultur kann so als Instrument des Konfliktes genutzt werden.
Die Kultur kann in Konflikt- und Postkonfliktsituationen auch dadurch wirken, dass sie in die Zivilgesellschaft wirkt. Idealerweise sollte die Inspiration durch Kultur die Politik das Machbare machen lassen und dann wieder hinterfragen. Wichtig ist auch Kinder in Spiel, Sport und Musik zusammenzubringen, damit wir eine neue Generation von morgen aufwachsen sehen.
Zur Abschreckung und um Krieg zu verhindern, brauchen wir Waffen. Wir haben gesehen, dass Putin keine Rücksicht nimmt. Wo er glaubt, gewinnen zu können, geht er mit der brutalsten Gewalt rein. Es ist ein Vernichtungsfeldzug, den er gegen die Ukraine führt. Dagegen müssen wir uns wappnen. Keiner soll denken, er macht Halt, wenn er das kriegt, was er braucht.
Thomas Körner hat „Deutschland als Männerrepublik“ beschrieben. Wann wird es ein Königinnenreich geben?
(Sie lacht.) Königinnen will ich nicht. Die Gleichstellung ist jedoch immer noch eine Frage. Was ich erschreckend finde, ist, dass in den Vorständen der DAX Unternehmen noch wenig Frauen sind. Viele geben schnell wieder auf, denn wer in einer Männerwelt in solchen Positionen arbeiten will, muss sehr hart sein und sehr männliche Eigenschaften haben. Auch erschreckend ist, dass in unserer heutigen Zeit die sexualisierte Gewalt gegen Frauen immer noch hoch ist. Laut Kriminalstatistik wird fast jeden Tag in Deutschland eine Frau Opfer eines Femizids, also eines Mordes auf Grundlage des Frauseins.
Die Haltung von Gisèle Pelicot in Frankreich bemerkenswert: „Die Scham muss von uns auf die andere Seite gehen!“ Einer Reporterin sagte sie, dass ihre Stärke nur eine Hülle und innen alles kaputt sei. In der eigenen vertrauten Umgebung, wo man sich sicher glaubt, das Gendergap finden wir überall. Da haben wir noch viel zu tun. In Spanien wurden in den letzten Jahren viele gute Gesetze für Frauen verabschiedet, z.B. das „Nur Ja ist Ja“ und nicht „Nein ist nein“. Das ist eine andere Dimension. Leider ist das geschriebene Gesetz noch nicht das gelebte Gesetz. Diese Machtausübung der Vergewaltigung geht bis in die sogenannten besseren Kreise, und wird immer noch als Kriegswaffe eingesetzt.
Was möchten Sie der hiesigen Deutschen Community in dieser Zeit der Unruhe und kurz vor Weihnachten mit auf den Weg geben?
Ich hoffe, dass sie ihr gutes Verhältnis zu Deutschland im Auge behält, auch wenn wir gerade Schwierigkeiten haben. Deutschland bleibt ein starkes Land und wird die aktuellen Schwierigkeiten überwinden. Ich bin immer sehr gern in Spanien, weil es eine sehr ausgeprägte Deutsche Community gibt. Als Gesundheitsministerin konnte ich mich darum kümmern, dass sie von den gesetzlichen Krankenkassen besser bezahlt wurden und auch bei den Pflegeleistungen Fortschritte gemacht wurden. Wichtig ist, dass wir sehr gute Deutsche Auslandsschulen mit sehr gutem Lehrpersonal haben, die in digitaler Vorbereitung, das haben wir in der Corona-Zeit gesehen, wesentlich besser aufgestellt sind als inländische. Trotz aller Schwierigkeiten ist es vielen Ländern in Europa noch nie so gut gegangen.
Frau Schmidt, wir danken für das interessante Gespräch
Ina Laiadhi, im November 2024
Schlagwörter: Frauen, Interviews, Moderne Welt

 Share On Facebook
Share On Facebook Tweet It
Tweet It