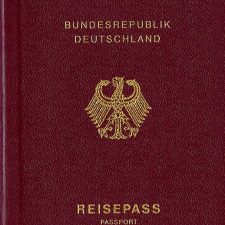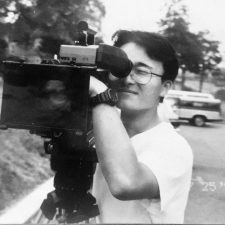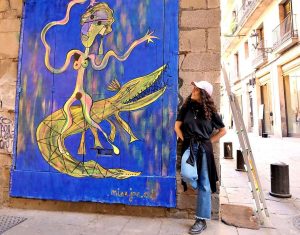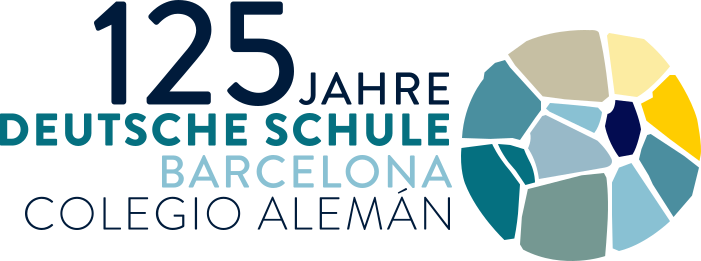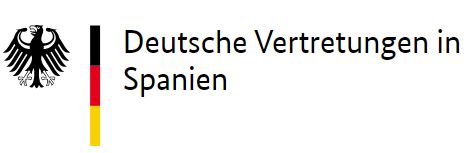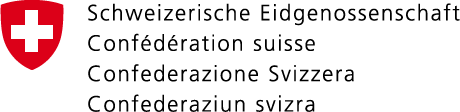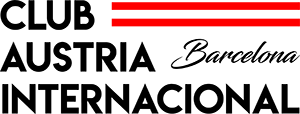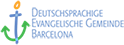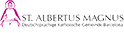La Pastorale – Ludwig van Beethovens Liebeserklärung an die Natur

Beethovens Pastorale im Original
Ludwig van Beethoven schätzte seine regelmäßigen Sommeraufenthalte auf dem Lande rings um Wien über alles, und er hat sich immer wieder in hymnischen Worten darüber ausgelassen: “Ist es doch, als ob jeder Baum zu mir spräche auf dem Lande: heilig, heilig! Im Walde Entzücken! Wer kann alles ausdrücken?!“ In der Natur, fern von jeder Gesellschaft, fand er Zuflucht, besonders als ihm die zunehmende Erkrankung des Gehörs zu schaffen machte.
An Therese Malfatti schreibt er: “kein Mensch kann das Land so lieben wie ich – geben doch Wälder, Bäume, Felsen den Widerhall, den der Mensch wünscht.“ Diesen Widerhall der Natur hat er in der Pastorale besonders interpretiert.
“Erwachen heiterer Gefühle bei der Ankunft auf dem Lande”
(1. Satz Allegro ma non troppo)
Hier streift ein Mensch durch die Natur, einsam, aber erfüllt von den Eindrücken.
Beethoven liebte es, unter Bäumen, umgeben von Wiesen, Blumen und Kräutern spazieren zu gehen. Der Duft, die Vielfalt der Farben die Sonnenstrahlen, das Rascheln der Blätter, das Zwitschern der Vögel oder das Plätschern der Bäche: all das muss als Anregung für seine wunderschöne Sechste Sinfonie, F-Dur, op. 68, die “Pastorale” gedient haben.
Entstanden ist die “Pastorale” vorwiegend in den Jahren 1807 und 1808, quasi gleichzeitig mit der Fünften Sinfonie. Beide wurden Beethovens fürstlichen Gönnern Franz Joseph Maximilian Fürst Lobkowitz und Andreas Kyrillowitsch Graf Rasumowsky gewidmet.
“Szene am Bach”
(2. Satz Andante molto mosso)
In seinen Briefen schreibt er häufig, “wie gut ich die Natur doch verstehe”. Im zweiten langsamen Satz drückt sich eine lyrische Idylle aus, aus der man die Geräusche eines friedlichen, von einem Bach durchflossenen Tales heraushören kann. Beethoven hat die “Szene am Bach” in Nussdorf und Grinzing geschrieben. Zwischen beiden Ortschaften fließt der Schreiberbach. Als Bemerkung schrieb Beethoven in sein Skizzenbuch “Murmeln des Baches”, und der Meister meinte, dass die Goldammern und Nachtigallen fleißig beim Komponieren mitgeholfen haben. Deutlich werden am Ende der Gesang der Nachtigall (Flöte), der Wachtelruf (Oboe) und der Kuckuck (Klarinette).
“Lustiges Zusammensein der Landleute”
(3. Satz Allegro)
Dieser Satz ist dem Vergnügen der Dorfgemeinschaft gewidmet. Die Bauern stampfen und drehen sich zu den Klängen eines Tanzes, und die Dorfmusikanten (Oboen und Klarinetten) treiben dazu ihre Späße.
“Gewitter, Sturm”
(4. Satz Allegro)
Auf einmal zieht ein Sommergewitter auf. Unmissverständlich kommt der Sturm, das Grollen der Celli und der Kontrabässe. Donnerschläge der Pauke, Blitze und peitschende Regengüsse in kaskadenhaften Abwärtsmotiven der Geigen. In diesem Satz verzichtet Beethoven auf konkrete Themen und untermalt das Geschehen mit Klangeffekten, Paukenwirbel und extrem hohen Einsätzen der Pikkoloflöte. Zu hören sind nicht die Donnerschläge selbst, sondern die erschreckende Wirkung auf den Menschen.
“Hirtengesang – frohe und dankbare Gefühle nach dem Sturm”
(5. Satz Allegretto)
Auch das erleichterte Gefühl, das man verspürt, wenn sich ein Gewitter wieder verzieht, hat Beethoven eindringlich in Töne gesetzt. Der “Hirtengesang” wird abgelöst von einer wunderschönen Melodie, aber er kehrt variiert immer wieder zurück. Mit einem Hymnus auf die Natur endet die Sinfonie.
Die Sinfonie Nr. 6 ist keine Beschreibung der Natur, sie ist ein Dialog zwischen ihr und dem Menschen. Beethoven selbst erklärte zu diesem Werk “mehr Ausdruck der Empfindung als Malerei”. Als Komponist dringt Beethoven ein in die Natur, in den Wald, in die Wiesen, in die Farbenwelt und gibt wieder, was er spürt und fühlt. Seine Musik vermittelt den Ausdruck seelischer Empfindung, wie dies in den Satzüberschriften niedergeschrieben ist.
Von Petra Eissenbeiss
Schlagwörter: Europa, Geschichte, Kultur, Musik

 Share On Facebook
Share On Facebook Tweet It
Tweet It