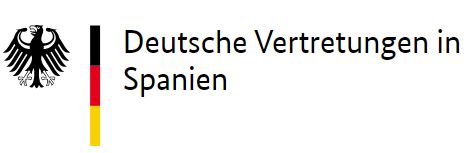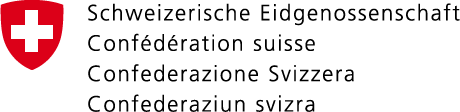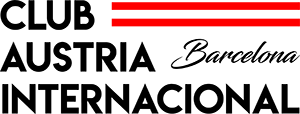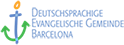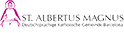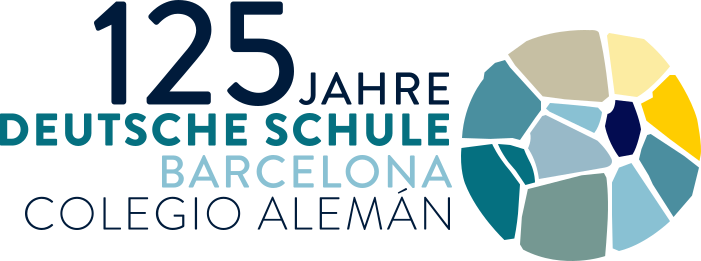#Me too Debatte im Goethe-Institut
 Oooch, noch ne #me too-Debatte. Ist da nicht schon alles gesagt von Alyssa Milano über Brigitte Bardot bis Kate McKinnon. Selbst die Kebekus, die immer für einen pointierten Kommentar gut ist, schien im Spiegel-Interview nichts mehr hinzufügen zu können.
Oooch, noch ne #me too-Debatte. Ist da nicht schon alles gesagt von Alyssa Milano über Brigitte Bardot bis Kate McKinnon. Selbst die Kebekus, die immer für einen pointierten Kommentar gut ist, schien im Spiegel-Interview nichts mehr hinzufügen zu können.
Gut, dass ich mich doch entschlossen habe, als Frau Haltung zu zeigen und hinzugehen. Denn anstatt des allumfassenden Anklagens und Schwarztragens und des replizierenden Abwiegelns und Auf-die-leichte-Schulter-nehmens gab es hier eine interessante und kurzweilige Kulturdebatte.
Klar, das Thema, mit dem sich die Professorin für Anglistik der Universität Zürich Elisabeth Bronfen und der Philosoph und Professor an der Universität der Künste Berlin Alex Garcia Düttmann befassten, hieß „Was macht #metoo mit der Kultur“.
Die beiden lieferten sich einen Schlagabtausch, den so niemand erwartet hatte, am wenigsten wahrscheinlich die Moderatorin Mercé Oliva, ihres Zeichens selbst Professorin an der Universität Pompeu Fabra, die nach der kurzen Einführung zwischen den beiden gar nicht mehr zu Wort kam.
Zeitweise fühlte ich mich an das literarische Quartett in seinen besten Zeiten erinnert, inklusive dem Gefühl, die einschlägigen Werke der letzten 30 Jahre nicht gesehen, nicht gelesen oder nicht verstanden zu haben. Da saßen sich zwei gegenüber, die wussten, wovon sie reden, wenn es um die Einflüsse der amerikanischen auf die europäische Kultur geht, die provokant als ein auslaufendes Modell bezeichnet wurde. Die amerikanische Kultur sei gewalttätiger, stark puritanisch und von einer großen Nervosität, die Sexualität betreffend geprägt. Es gebe einen nicht funktionierenden öffentlichen Raum und keine ausreichende Regelung zu Sexualität am Arbeitsplatz. Dies erkläre zum einen, mit welcher Heftigkeit die #metoo-Kontroverse angestoßen wurde, zum anderen auch die teilweise extreme zeitliche Verzögerung der angeklagten Verhaltensweisen. Es gab einfach bisher für diese Debatte keinen Raum.
Angeschnitten wurde auch die Frage, ob die Kunst durch das Verhalten des Künstlers kontaminiert ist. Eine Frage, deren Brisanz sichtbar wird, wenn man bedenkt, wie in Hitler-Deutschland mit so genannter entarteter Kunst umgegangen wurde. Wollen wir einen Film sehen, der bisher von Kritikern hochgelobt wurde, von dem sich jetzt aber herausstellt, dass ihm Vergewaltigung und Missbrauch zugrunde liegen? Eine Frage, die jeder für sich selbst beantworten muss. Aber wie Garcia Düttmann formulierte, wichtig ist, die Frage stellen zu können und zwar in beide Richtungen. Tabuisierung und Schweigen helfen nicht. Das ist der klare Konsens der Veranstaltung. Wir müssen an den Figuren arbeiten, die wir entwerfen. Und: Victim is not a good role model!
In diesem Sinne unseren herzlichen Dank an das Goethe-Institut, das uns diese feine Kulturdebatte aus öffentlichem Anlass kredenzte.
Von Kati Niermann
Schlagwörter: Ausbildung, Frauen

 Share On Facebook
Share On Facebook Tweet It
Tweet It