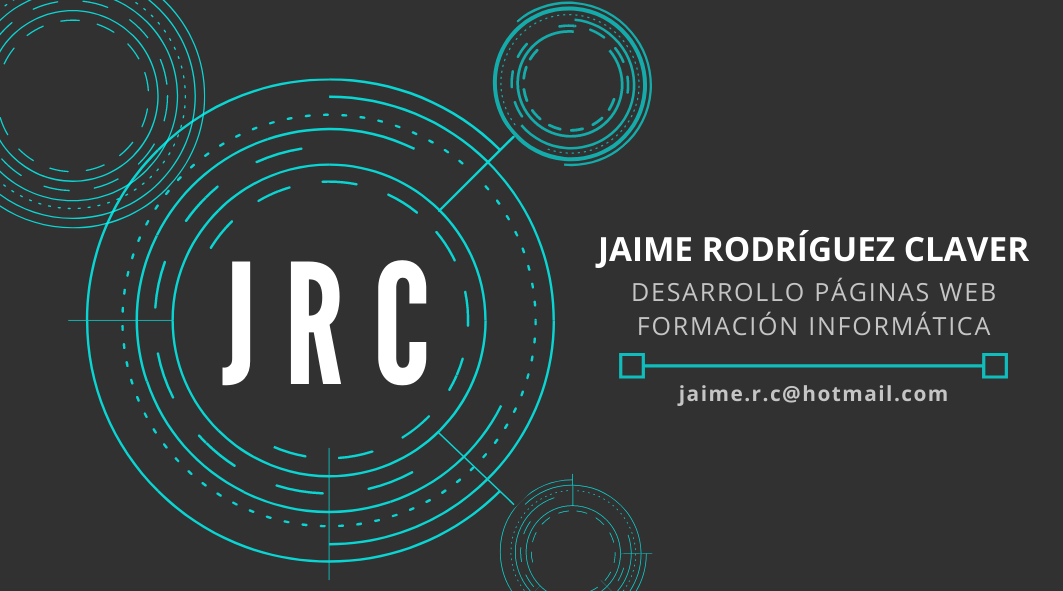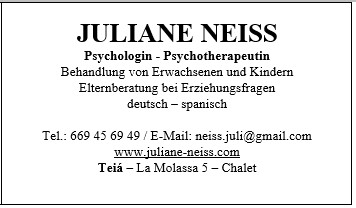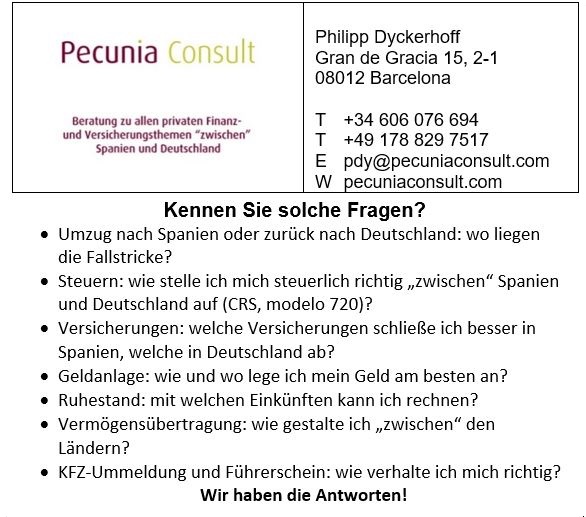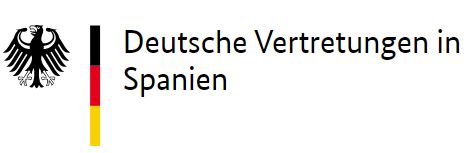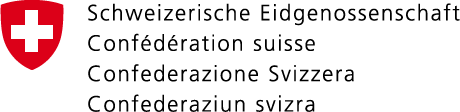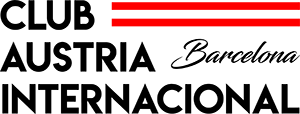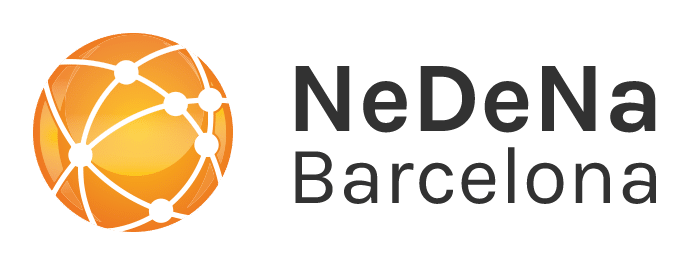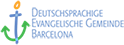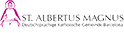“Musik ist eine internationale Sprache, die Brücken schlägt”

Christina Scheppelmann, Intendantin des Liceu Barcelona bis 2019, Foto laiadina
Interview mit Christina Scheppelmann, Intendantin im Liceu Barcelona
Frau Scheppelmann holt uns am Eingang des Liceu ab, als gerade auf der Rambla ein Umzug aus Anlass der Fiesta de la Santa Eulália stattfindet und die Heilige Eulalia als Riesenpuppe vorbeizieht. Sie trägt einen (Taschen-)Spiegel in der Hand.
Frau Scheppelmann, Sie haben in den Opernhäusern von Mailand, Venedig, San Francisco, Washington und Oman gearbeitet. Jetzt sind Sie “Artistic and production director general” in Barcelona. Was hat Sie befähigt hier diesen Posten zu übernehmen und was hat Sie gereizt daran?
Ich arbeite seit 29 Jahren in dieser Branche. Vorher habe ich zweieinhalb Jahre lang das Theater in Oman geleitet und dort vieles auf den Weg gebracht. Es hat mir viel Spaß gemacht, es war faszinierend. Ich bin, das klingt jetzt ein bisschen arrogant, eine der wenigen, die auf drei Kontinenten gearbeitet hat, heute im Zuge des internationalen Musikbusiness ist das schon ein Vorteil. Ich komme zwar aus Europa, habe aber lange nicht hier gelebt. Nach Mailand und Venedig sowie Barcelona 1992 bis 1994 – ich habe den Brand miterlebt- war ich lange in Amerika, dann zweieinhalb Jahre in Oman und bin jetzt wieder in Barcelona. Ich bin ein bisschen herumgekommen und spreche deshalb fünf Sprachen. Oman ist übrigens kein Opernhaus, sondern ein Center für Performing Arts. Ein Drittel des Programms wird von arabischen Künstlern bestritten, das ich mit einem eigenen Berater für Arabische Musik gestaltete. Ursprünglich sollte es „House of Music“ heißen und nicht „Royal Opera House“, denn es ist Konzertsaal und Opernhaus in einem. Je nach Anforderung verwandelt sich es dank seiner technischen Möglichkeiten von einem ins andere. Man kann nicht einfach ein Opernhaus aus dem Boden stampfen. Dazu gehört mehr als ein Gebäude. Die Jahre in Oman waren eine tolle Herausforderung. Ich wäre gerne noch dort geblieben, weil ich ein sehr gutes Vertrauensverhältnis zum Aufsichtsrat hatte. Es ist mir sehr schwer gefallen, Ja zum Wechsel nach Barcelona zu sagen.
Aus professionellen und privaten Gründen bin ich nach Barcelona gekommen. Barcelonas Liceu gehört zu den großen Häusern, immer schon. Ich habe hier schon mal gelebt. Die Stadt gefällt mir sehr gut. Meine Familie lebt hier. Ich spreche Spanisch, Katalanisch verstehe ich. Von Anfang an wurde zu Hause Spanisch gesprochen, da mein Vater Spanier ist. Auch mit meiner deutschen Mutter spreche ich heute nur Spanisch.
Welche Bilanz ziehen Sie heute für die Oper?
Ich persönlich halte sehr viel von Musik als solcher. Musik ist eine internationale Sprache, die unabhängig von Grenzen und sprachlichen Barrieren in der Lage ist, Brücken zu schlagen, zu kommunizieren, egal, woher Sie kommen und welche Sprache Sie sprechen. Musik ist in der Lage, international Menschen wirklich zusammenzubringen.
Ich habe in Washington eine “Hochzeit des Figaro” gemacht mit zwei Besetzungen. Es waren 14 Nationen vertreten in diesen zwei Besetzungen. In dieser Beziehung sind wir besser aufgestellt als die Vereinten Nationen, weil wir zusammenarbeiten, nicht gegeneinander, auch wenn wir nicht die gleiche Sprache sprechen. Das funktioniert ebenfalls bei anderer Musik, Jazz oder Pop. Musik bringt etwas zusammen, das fasziniert mich auch an der Oper. Die Oper bringt Leute zusammen. Sie hat zudem den Vorteil, dass sie eine Geschichte erzählt. Man hat Kostüme, Bühnenbild, eine Handlung, insofern erleichtert das die Kommunikation der Musik.
Ich glaube aber, dass wir viel mehr Neues wagen sollten. Stücke von lebenden Komponisten wie Wolfgang Rihm oder von vor kurzem verstorbenen Komponisten wie Hans Werner Henze werden selten. In den Vereinigten Staaten zum Beispiel werden zeitgenössische Komponisten häufiger aufgeführt. Das steht in keiner Proportion zu den zeitgenössischen Stücken, die hier inszeniert werden.
Gibt es das Publikum dafür?
Erst kommen die Stücke und dann das Publikum. Sie müssen dem Publikum etwas Neues bieten, damit es kommt. Wenn Sie die Stücke nicht realisieren, können Sie auch kein Publikum aufbauen.
Warum ist die Oper eine Kunst für ältere Musikliebhaber? Jüngere Leute zahlen heute lieber für ein Fußballspiel als eine Opernkarte.
Das haben sie vor 40 Jahren auch gemacht. Wenn Sie sich alte Schwarz-Weiß-Fotos z.B. von den Salzburger Festspielen anschauen, sehen Sie mehr weiße Haare als sonst etwas. Das Publikum der Oper war immer ein bisschen älter. Man hat verpasst, rechtzeitig neue Werke anzubieten. Wen interessiert denn eine Geschichte aus dem 19. Jahrhundert? Die meisten jungen Leute kennen die klassischen Mythologien nicht und haben weder Goethe noch Schiller gelesen. Wer keine Stücke auflegt, die heutige Geschichten erzählen, kann auch kein jüngeres Publikum anziehen. Mir wäre es lieber, jemand schriebe ein kurzes Stück über die syrischen Flüchtlinge.
Werden Sie das Programm auch in diese Richtung ändern?
Es ist nicht einfach, einen Saal für 2.300 Leute mit zeitgenössischen Stücken zu füllen. Die Begrenzung des Budgets tut das ihre. Man kann nicht das aufholen, was 30 Jahre lang verpasst wurde. Junge Komponisten werden nicht genügend gefördert. Man kommt nicht aus dem Konservatorium und kann Stücke schreiben. Junge Sänger singen nicht gleich den Siegfried. Sie werden durch zahlreiche Programme gefördert. Sie fangen mit kleineren Partien an und entwickeln ihre Stimme. Einige werden nie Wagner singen, sie bleiben bei Mozart. Warum erwarten wir, dass Komponisten einfach so vom Himmel fallen?! Da müssen Förderprogramme her, damit sich das langsam entwickelt.
Nach welchen Kriterien werden die Künstler ausgesucht? Welche Rolle spielt das Geld dabei?
Die Künstler müssen singen können und überzeugend sein. Sie suchen sich denjenigen aus, der die Rolle singen kann. Das hat mit dem Geld nichts zu tun. Die hauptsächlichen Kosten werden vom Bühnenbild und den Kostümen verursacht, nicht von den Sängern. Die Einzelgagen fallen im Gesamtprojekt weniger ins Gewicht. Da die Künstler nur 7 oder 8 Vorstellungen geben, bleiben die Gagen überschaubar, auch wenn es 2.000 bis 20.000 Euro sind.
Bei der Titelauswahl denken Sie immer ans Budget. Wenn ich „Die Meistersinger“ und „Boris Godunow“ spiele, dann habe ich schätzungsweise 75% des Budgets verbraucht. Da bleibt für andere Titel nicht mehr viel übrig. Insofern muss ich schon gucken, was ich spiele. Eine „Zauberflöte“ wird immer weniger kosten als „Die Meistersinger“. Ein großer Chor und Orchester kosten mehr, als eine Mozart-Oper. Das sind Kosten, an denen ich nichts ändern kann.
Wie hat Sie die Zusammenarbeit mit Placido Domingo beeinflusst?
Für mich ist Placido Domingo einer der hervorragendsten Künstler und Sänger der Operngeschichte als Musiker, als Sänger, als Arbeitstier. Es hat so etwas nie gegeben. Er stoppt nie. Er ist einer, der nie stillsitzen kann. Es war eine faszinierende Zusammenarbeit.
Was ist die wichtigste Eigenschaft, die ein Intendant/ eine Intendantin haben muss und warum?
Auf Englisch nennt sich das „Jack of all trades, master of non“. Man muss von allem etwas wissen. Sprachen sind wichtig, Flexibilität, Anpassungsfähigkeit, Psychologie und ein gutes Feingefühl. Man muss mit so vielen verschiedenen Charakteren arbeiten. Respekt: der Pförtner und der Techniker sind genauso wichtig wie der Dirigent. Man muss sich dessen bewusst sein, dass es im Theater auf jeden ankommt. Meine Ausbildung zur Bankkauffrau kommt mir sehr zu Gute. Sie müssen als Intendant etwas von Finanzen wissen, Zahlen verstehen. Sie müssen Verträge verhandeln. Ebenso müssen Sie die Stücke kennen, die Partituren, weil Sie sich sonst mit den Sängern nicht unterhalten können. Mir macht diese Arbeit Spaß eben wegen dieser Vielseitigkeit.
Im letzten Taschenspiegel schrieben wir über Opernaufführungen, die live in Kinosälen übertragen wurden. Sehen Sie solche Veranstaltungen als Konkurrenz?
Es ist eigentlich das Gleiche. Diejenigen, die in die Oper kommen, gehen auch dort rein. Nicht jeder ist finanziell in der Lage zu reisen. Für die Interessierten ist das schon gut, weil Sie Opern aus Mailand oder Rom sehen können. Es ist keine Konkurrenz, denn der Eintrittspreis ist nicht das Hindernis. Wer kein Interesse hat, geht auch nicht ins Kino, um die Oper zu sehen. Die, die normalerweise nicht in die Oper gehen, werden auch nicht ins Kino gehen.
Persönlich stört mich, dass der Kameraregisseur entscheidet, was ich sehen werde. Ich entscheide es nicht selbst. Wenn ich im Publikum sitze, entscheide ich selber, was ich sehe. Auch sind Großaufnahmen für die Sänger sehr anstrengend, mir haben viele der Sänger gesagt, dass es ihnen unangenehm ist. Bei Life-Übertragungen ist extra Druck drauf. Natürlich strengen sich die Sänger besonders an, weil dieser Druck da ist. Ich kenne Künstler, die ihre Karriere wegen des Lampenfiebers aufgegeben haben. Kehren Sie mal Ihr Innerstes nach außen, wohl wissend, dass 20.000 oder noch mehr Leute in Kinosälen zuschauen.
Die Fassadenrenovierung des Liceu ist ein bisschen in die Kritik geraten. Finden Sie, dass das Geld besser hätte angelegt werden können, um im Inneren etwas zu verbessern (Gehälter, Produktionen, Ausstattungen…)?
Dies hat nichts mit dem Budget des Theaters zu tun. Das ist ganz getrennt, die Ringe sind ein Kunstobjekt. Das Kunstwerk soll von einem Mäzen geschenkt werden. Die Renovierung der Fassade dagegen ist dringend notwendig. Wenn das nicht bald passiert, fällt jemandem etwas auf den Kopf. Bisher ist das Fassadenprojekt lediglich ein Vorschlag, aber es ist bisher weder genehmigt noch bestätigt worden. Da müssen sich mal ein paar Politiker zusammenraufen und etwas entscheiden.
Denken Sie nach Ihrer Erfahrung in Oman, dass die Kunst zur Emanzipation der Region beitragen und eine kulturelle Brücke sein kann?
Für mich sind Emanzipation und kulturelle Brücke zwei verschiedene Aspekte. Unser Konzept der Emanzipation ist auf die Region nicht anwendbar. Es ist eine inakzeptable Tendenz, dass wir unsere Parameter auf die arabische Welt übertragen, ohne zu wissen, wie diese Leute denken und leben. Wir können nicht von den Leuten, die in der Wüste leben, erwarten, dass sie so denken wie wir. Ich glaube, es wird sich auch in der arabischen Welt etwas ändern, aber das dauert. Das geht in Zyklen, das können wir nicht kontrollieren.
Die Kunst als kulturelle Brücke, ja. Es gibt sehr gute arabische Musiker. Ich fände es schön, wenn sie hierher kommen würden. Mein Wunsch wäre es mit Flamencogitarristen und Oud-Musikern aus Abu Dhabi hier zu arbeiten. Das ist nicht ganz einfach, weil viele der arabischen Stars in ihren Heimatländern sehr hohe Gagen gewöhnt sind. Deshalb kommen sie nicht hierher, weil sie weniger gut bezahlt werden. In der Beziehung natürlich kann Musik Brücken bilden, wegen der Internationalität der Musik als Sprache und weil sie eine emotionale Sprache ist.
Von Ina Laiadhi und Sabine Bremer
Schlagwörter: Barcelona, Interviews, Musik

 Share On Facebook
Share On Facebook Tweet It
Tweet It