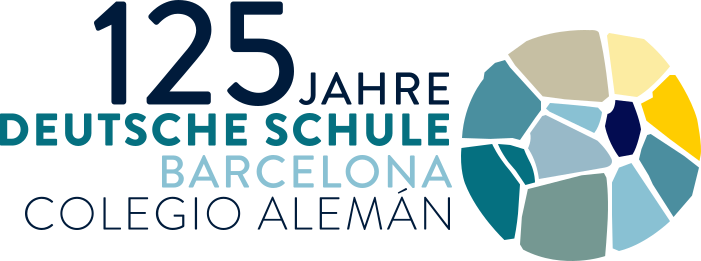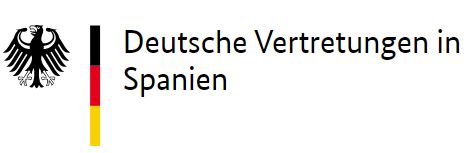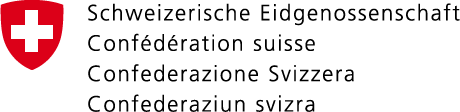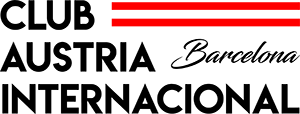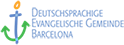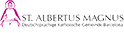Interview mit Prof. Dr. Naika Foroutan
 Migration wird zur umkämpften Ressource
Migration wird zur umkämpften Ressource
Interview mit Prof. Dr. Naika Foroutan, Leiterin des Berliner Instituts für empirische Integrations- und Migrationsforschung (Humboldt-Universität Berlin) und seit 2017 Leiterin des Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung (DeZIM).
Prof. Dr. Foroutan und ich lernten uns bei ihrem Besuch im Goethe-Institut Barcelona im April anlässlich der Debatte „Einwanderung und Exil: Perspektiven der Forschung” im Rahmen der Walter-Benjamin-Woche kennen. Das Interview führten wir per Videokonferenz.
Als Leiterin der Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung haben Sie sich ausgiebig mit Einwanderung befasst. Mit welchen Herausforderungen waren Sie während Ihrer Recherche konfrontiert?
Wir haben das Deutsche Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung 2016 ins Leben gerufen, direkt nach der großen Fluchtwelle 2015/16. Die größte Herausforderung war, dass Migrationsforschung in Deutschland damals ein kleines Fach war, während Deutschland sich zur zentralen Achse der Migration in Europa entwickelte. Der Bedarf an Forschung stieg plötzlich enorm, nicht nur bei Politik und Zivilgesellschaft, sondern auch bei Kommunen und der breiten Öffentlichkeit. Bürgermeister, kleinere Städte und Kommunen, die plötzlich Geflüchtete aufnehmen mussten, meldeten sich. Besonders in Bayern, als Grenzregion, kamen viele Menschen an, und die Strukturen waren völlig unvorbereitet. Deutschland war durch die Dublin-Regelung bis dahin eher am Rand betroffen, da die Asylanträge an den südlichen Grenzen gestellt werden müssen. Wir haben uns mit sieben Zentren zusammengetan, um die Bundesregierung zu überzeugen, ein koordinierendes Zentrum in Berlin zu schaffen. Seit 2017 arbeiten wir empirisch mit fast 200 Kolleginnen und Kollegen. Ich leite das Zentrum gemeinsam mit meinem Kollegen Frank Kalter, einem Mathematiker und empirischen Sozialforscher. Während ich gesellschaftspolitisch und theoretisch arbeite, bringt er seine methodische Expertise ein. So bringen wir ganz unterschiedliche Facetten, politische Positionen und Methodentheorien zusammen, um maximal zu informieren, um vor allen Dingen zur Versachlichung der Debatte beizutragen.
Seit 10 Jahren ist Deutschland einer der weltweit wichtigsten und dynamischsten Migrationsakteure geworden. Wir versuchen, Zahlen und Befunde aufzubereiten für Politik, Zivilgesellschaft und breitere Öffentlichkeit.
Welche Ergebnisse haben Sie bei Ihren Forschungen überrascht?
Wir haben den Rassismusmonitor für die Bundesregierung erstellt, der nach dem Anschlag 2020 in Hanau in Auftrag gegeben wurde. Kanzlerin Merkel und Innenminister Seehofer stellten nach mehr als einer Dekade rassistischer Morde des NSU In Deutschland – und nach der Mordserie in Kassel, Halle, Hanau – das Thema Rassismus in den Mittelpunkt. Es gab aber in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern kaum verwertbare Daten. Überrascht hat uns, dass etwa 90% der Deutschen der Überzeugung waren: Ja, es gibt Rassismus in Deutschland. Es gab keine Verleugnung, wie wir erwartet hätten – vielmehr wurde in den Umfragen klar, dass die Mehrheit der Menschen nicht nur Rassimus zur Kenntnis nahmen, sondern auch in ihrer großen Mehrheit als Thema relevant fanden und als Bedrohung für die Gesellschaft wahrnahmen.. Wir dachten, über Rassismus zu sprechen, sei in Deutschland kaum möglich, da Rassismus vor allem mit den USA oder Neonazis assoziiert würde, aber nicht mit dem eigenen Verhalten. Diese Erkenntnis, dass Rassismus nicht nur ein Thema von Minderheiten ist, sondern auch die breite Mehrheit beschäftigt, zeigte uns, dass die Politik darauf reagieren und es zu einem besprechbaren Thema machen könnte.
Die Einwanderung leidet unter der Integration. Was bedeutet Integration für Sie?
Wir haben uns am DeZIM intensiv mit dem Begriff auseinandergesetzt. Die Kritik am Integrationsbegriff war, dass er nur auf Immigranten und Immigrantinnen bezogen wurde. Integration implizierte, da gibt es eine Kerngesellschaft, bei der alles ok ist, die haben keine Schwierigkeiten, und die, die dazukommen, müssen sich jetzt maximal anpassen und möglichst alles verlieren, was sie mitbringen. In Deutschland ist das Wort „Integration“ eher mit Assimilation verknüpft: Alles ablegen, kulturelle Spezifika, Sprache, Habitus, Religion. Und so werden, dass man nicht mehr erkannt wird. Das hat sich aber in den letzten Jahren stark verändert. Wir widmeten uns daher dem ursprünglichen Begriff der Integration, wie er aus der Weimarer Republik bekannt war: Die Ermöglichung zu zentralen Gütern der Gesellschaft. Dass allen Menschen gleichermaßen Zugang zu Ressourcen und das Recht auf Anerkennung, Chancengerechtigkeit und Teilhabe zusteht, und zwar egal ob sie Ostdeutsche sind, Menschen mit Behinderungen, Frauen, Migranten und Migrantinnen, etc. Dort, wo man merkt, dass Strukturen nicht entsprechend der Bedarfe einer demokratischen Bevölkerung existieren, ist es eine Bringschuld der Regierung, nachzubauen, das betrifft Sprachschulungen, aber auch den regelmäßigen Busverkehr aus ländlichen Regionen oder den Zugang älterer Menschen zum Internet oder zu Pflegeeinrichtungen. Wir arbeiten bei uns am DeZIM mit diesem erweiterten Integrationsbegriff.
Carolin Emcke hat vor Jahren ein Buch „Gegen den Hass“ geschrieben. Wie können wir es schaffen, dass statt Wut mehr Gelassenheit herrscht?
Das ist eine sehr schwere Frage, die mir schwer fällt zu beantworten. Der erweiterte Integrationsbegriff, den wir haben, der führt auch unseren Blick in ganz unterschiedliche Formen von Wut, Hass und Hetze. Wir untersuchen am Institut auch Konflikte. Wut ist nicht nur bei denen vorhanden, die schon immer Vorort waren, gegen die, die neu angekommen sind, sondern auch die, die neu ankommen, tragen Wut, Hass und Hetze mit sich.
Die Welt ist globaler geworden, die globalen Konflikte spiegeln sich in den Ankunftsstaaten wider. Menschen kommen wegen z.B. der Klimakatastrophe, Kriegen oder Armut nach Europa. Die Konflikte sind nicht mehr fern. Dazu hat auch das Internet stark beigetragen, weil man jetzt viel informierter über Konflikte in der Welt ist. Das beschäftigt uns alles sehr. Die neue Informiertheit bringt die Konflikte stärker hierher.
Glauben Sie, dass das deutsche Modell im Vergleich zu Europa vorbildlich ist? Weil es so viele Flüchtlinge aufgenommen hat.
Deutschland hat sich in den letzten 10 Jahren zu einem der dynamischsten Migrationsakteure weltweit entwickelt. Es steht an Platz 2 hinter den USA bei den absoluten Migrationszahlen. Auch bei der Geflüchtetenaufnahme gehört Deutschland seit einem Jahrzehnt zu den TOP 5 – nur Iran, Türkei und Kolumbien liegen davor, kein europäisches Land. Das zeigt, wie viel Deutschland in den letzten Jahren geleistet hat.
Wenn Menschen heute sagen, sie fühlen sich überfordert und das Land habe sich sichtbar verändert, dann haben sie natürlich Recht. Das darf man ihnen nicht absprechen. Gleichzeitig muss man sehen: Deutschland ist im internationalen Vergleich gut durch die Coronakrise gekommen – auch, weil 2015/16 viele Menschen zu uns kamen. Engpässe in systemrelevanten Berufen konnten dadurch besser aufgefangen werden. Der Lockdown erforderte Arbeitskräfte vor allem in systemrelevanten Bereichen – etwa bei Lieferdiensten, in der Reinigung, im Krankenhaus oder im öffentlichen Nahverkehr – Tätigkeiten, die stark von immigrantischer Arbeit profitieren konnten.
2015/16 war eine Zeit der Überforderung, weil viele Strukturen fehlten, als auf einmal sehr unkontrolliert über eine Million Menschen hierherkamen. Aber dieses “Polster” hat fünf Jahre später in der Coronazeit geholfen. Heute sind 81 % der Männer, die damals kamen, in sozialversicherungspflichtigen Jobs. Frauen arbeiten seltener – z.B. wegen fehlender Kita-Plätze. Man kann der Bevölkerung schwer sagen: “Wartet ein paar Jahre, dann zahlt sich das aus.” Aber es ist nun mal so.
Man darf nicht vergessen: Nach der Finanzkrise 2008/09 folgte eine lange Austeritätspolitik – mit wenigen Investitionen in Infrastrukturen wie Straßen, Brücken, Bahn, Kitas, Schulen oder Theater. Es gab Sozialabbau, um die schwarze Null zu erreichen. Dann kamen die Geflüchteten – und viele Menschen hatten das Gefühl, sie mussten jahrelang sparen, und „denen“ werde nun alles hinterhergeworfen. Die Engpässe in der Infrastruktur trafen auf eine große Zahl an neuen Migrantinnen und Migranten. Vieles wurde eher von der Zivilgesellschaft gestemmt als von der Politik.
Es ist wichtig, die Politikverdrossenheit aus dieser Zeit zu verstehen und aufzudröseln. Viele erinnern sich nicht mehr an die Austeritätspolitik – und geben Migrantinnen und Migranten die Schuld für viele aktuelle Probleme. Wir im DeZIM versuchen aufzuklären: Woher kommen die Engpässe wirklich? Denn es geht darum: Wer soll die Brücken bauen, wer die Pflegeheime entlasten? Wir haben einen Mangel sowohl im Fachkräftesektor als auch im Arbeitskräftesektor. Dieser Mangel ist so hoch, wie zum letzten Mal nach dem 2. Weltkrieg.
Bei Ihrem Besuch im Goethe-Institut sagten Sie, dass die AfD das Thema der Einwanderung für sich beansprucht habe. Glauben Sie, dass das Problem politischer, wirtschaftlicher oder kultureller Natur ist?
Die politische Frage hängt eng mit der erwähnten Austeritätspolitik zusammen. Die demokratischen Parteien werden seit mehr als 10 Jahren von der AfD mit der Migrationsfeindseligkeit vor sich hergetrieben. Sobald es einen migrationsoffenen politischen Ansatz gibt, schafft es die AfD mit Verweis auf Messerattacken und Vergewaltigungen – was es natürlich alles auch wirklich gibt, es geht nicht darum, das zu negieren –, diese kriminellen Handlungen allen Migrantinnen und Migranten in die Schuhe zu schieben. Ein infamer Versuch. Das ist so, als würde ich Pädophilie allen deutschen Männern nachsagen. Im Jahr 2023 registrierten die Strafverfolgungsbehörden 16.375 Fälle von sexuellem Missbrauch von Kindern – 54 pro Tag. Der Anteil der deutschen Tatverdächtigen belief sich auf 81,2 %, der Anteil der deutschen Männer lag da bei 94%. Auch wenn das täglich passiert, sind die Menschen sehr wohl in der Lage, nicht pauschalisierend zu sagen: „So sind sie halt die Deutschen“. Man kann sehr wohl einordnen, dass das nicht auf etwas schließen lässt, was den Charakter und die Kultur der Deutschen ausmacht. Bei der Migrationsfrage fehlt dieses Abstraktionsvermögen viel zu oft. So beantworte ich die Kulturfrage: Bei der Migrationsfrage geht es sehr stark um kulturelle Abwehr. Es ist nachvollziehbar, dass niemand sich mit Kriminellen umgeben möchte und will, dass es auf dem Weihnachtsmarkt terroristische Attacken gibt. Man kann nicht leugnen, dass die Zahl islamistischer Attacken zugenommen hat. Sie gehen vor allem auf das Konto von Geflüchteten aus muslimischen Ländern. Das sind Punkte, die besprochen werden müssen. Und gleichzeitig müssen wir unsere Freunde, Nachbarn, Kolleginnen, den Gemüsehändler, den Arzt von Vorurteilen ausnehmen und vor Rassismus und Diskriminierung schützen. Wir haben eine sehr hoch diversifizierte migrantische Gesellschaft. Die Vorurteile richten sich vor allem gegen Geflüchtete und gegen Muslime. Es gibt in Deutschland ca. 5,6 Millionen Muslime und laut Verfassungsschutz ca. 27.480 Islamisten, was einen Anteil von 0,49 % ausmacht. Die pauschalen, antimuslimischen Einstellungen gehen dennoch in die Höhe. Nur nochmal der Vergleich von eben: In Deutschland gelten 1% der Männer als pädophil – aber würden wir uns nicht zurecht schämen, wenn wir jeden dritten Tag in einer Talkshow darüber sprechen würden, ob die deutschen Männer wohl zu unserer Leitkultur passen?
Wir können das Zusammenleben nur gemeinsam gestalten, weil wir alle wie noch nie zuvor auf einander angewiesen sind. Wir haben in Deutschland bestimmte Bedarfslagen. Wir sind in der Demokratie unter Druck. Der Verbündete USA ist nicht mehr so zuverlässig wie vorher. Als Gesellschaft können wir es uns nicht leisten, von innen polarisiert zu werden.
Welche Rolle spielt der Einwanderer in dieser Debatte? Was macht einen guten Einwanderer aus?
Wenn wir Integration messen, messen wir das in vier Feldern. 1. Strukturelle Fragen: Nimmt jemand teil am Bildungsleben, am Arbeitsmarkt. 2. Soziale Integration: Vor allen Dingen in der Nachbarschaft, durch Vereinsmitgliedschaft oder Ehrenamt. 3. Kulturelle Integration: Da geht es um Sprache oder TV-Konsum. Und 4. Emotionale Integration: Fühlt sich jemand zugehörig zum Land, ist er bereit zu partizipieren. Wir haben bei Untersuchungen festgestellt, dass sobald die Information zu einem Migranten kam, dass er muslimisch ist, wurden von 30% der Befragten die emotionale Zugehörigkeit, dass er zur Gemeinschaft gehört, verwehrt. Ganz gleich ob es sich dabei um einen „guten Einwanderer“ handelte – mit hoher Bildung und sozialem Engagement. Wer ein „guter“ Einwanderer ist, hängt also nicht immer von objektiven Variablen ab, und wenn man seine Bringschuld erfüllt, heißt es nicht, dass man auch Anerkennung erfährt. Das Versprechen der Zugehörigkeit wird oft nicht erfüllt.
Was brauchen Intellektuelle, Künstler:innen und Journalist:innen heute, um dieses negative Bild der Einwanderung zu ändern?
Das finde ich eine sehr wichtige Frage. Wir arbeiten ja hauptsächlich auf Zahlenbasis. Aber pure Empirie ist heutzutage nicht von Erfolg gekrönt. Wir können noch so viele Zahlen liefern, das verändert nicht wirklich die Skepsis. Künstler und Künstlerinnen können veränderte Narrative, Geschichten der Begegnung aufschreiben, vielleicht auch Spiegelungen von historischen Parallelen. Damit wir in den Dialog kommen. Das kann mit Literatur oder Filmen sehr gut erfolgen. Wir haben Studien zu Stereotypen gemacht und festgestellt, dass gegen Ostdeutsche ähnliche stereotype Vorurteile wie gegen Migranten bestehen – auch Analogien können spannende Gedanken hervorbringen.
Glauben Sie, dass sich der Westen und der Osten angesichts der aktuellen internationalen Krisen annähern werden?
Ich glaube tatsächlich, dass die Migrationsfrage die Stellschraube dafür sein wird, in welche Richtung Europa sich entwickelt. Der Bedarf an Fach- und Arbeitskräften ist in unserer Servicegesellschaft sehr hoch. Die gleiche Situation haben Spanien oder Polen. Die Zeiten, in denen häufig polnische Migrant:innen nach Deutschland kamen, sind definitiv vorbei. Polen ist selbst ein Anwerbeland geworden. Kanada, USA und Australien bleiben Anwerbeländer.
Wenn Sie nach Westen und Osten fragen, dann ist für mich der Osten erstmal Asien. Was der deutschen Bevölkerung noch gar nicht bewusst ist, ist, dass erstmalig so große Volkswirtschaften wie Japan und Südkorea massiv in den Anwerbemarkt einsteigen, weil sie so überaltert sind und ihre Sozialsysteme und Renten nicht funktionieren werden, wenn nicht weitere Menschen hinzukommen, die arbeiten. Wir werben in den gleichen asiatischen Märkten. Außerdem steigen die Emirate gerade massiv ein und werben für ihr Golf-Futurismus-Programm an. Sie wollen jährlich eine Million Migrant:innen zu sich ziehen, um ihre hochambitionierten Projekte umzusetzen. Was uns nicht bewusst ist, ist, dass Migration in der kommenden Dekade zu einer umkämpften Ressource wird. Wir sprechen bei uns von migrantischem Gold. Deutschland ist in der OECD auf Platz 49 in der Beliebtheitsskala von 53. Das heißt, diejenigen, die nach Deutschland kommen, verlassen das Land relativ schnell wieder. Wir müssen attraktiver werden, weil wir geringere Gehälter zahlen als die Emirate, Japan oder Südkorea. Wir haben Angebote wie Sozialsysteme, freie Schulen, aber die Menschen gehen oft, weil sie das gesellschaftliche Klima in Deutschland nicht attraktiv finden.
Frau Prof. Dr. Foroutan, vielen Dank für das sehr aufschlussreiche Gespräch.
Von Ina Laiadhi, Juli 2025
Schlagwörter: Interviews

 Share On Facebook
Share On Facebook Tweet It
Tweet It