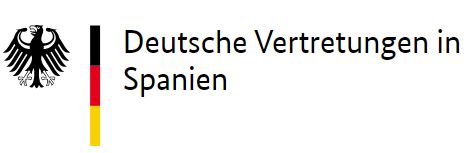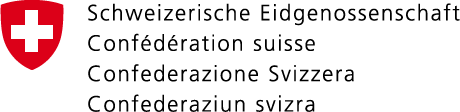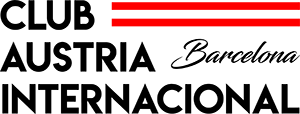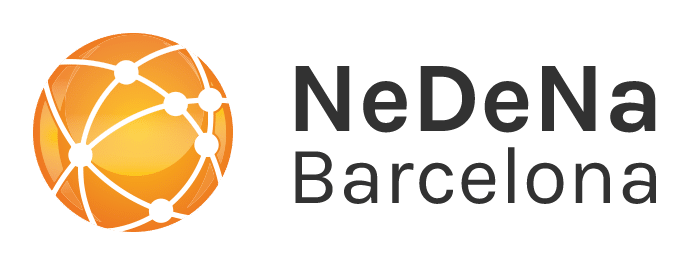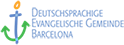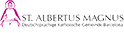Stress an sich ist keine Krankheit

Dr. Roser Nadal forscht und lehrt an der
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).
Interview mit Dr. Roser Nadal, Neurowissenschaftlerin, Forscherin und Dozentin an der UAB
Ende Januar trafen wir uns wegen Terminschwierigkeiten für dieses Interview via Teams.
Sie sind eine Frau mit vielen Facetten. Können Sie unseren Lesern und Leserinnen erklären, was es mit den Neurowissenschaften auf sich hat?
Neurowissenschaft ist eine Art, das Leben zu verstehen. Das Gehirn ist ein integraler Bestandteil unserer Persönlichkeit. Wir sind im Grunde genommen das Gehirn. Wenn ich Gehirn sage, dann meine ich das gesamte Nervensystem. Für mich ist es also spannend zu verstehen, wie unser individuelles Verhalten und unser soziales Umfeld funktionieren, und zwar nicht nur bei Menschen, sondern oft müssen wir Tiere verwenden, um Wirkmechanismen zu untersuchen, die wir aus ethischen Gründen nicht beim Menschen untersu-chen können. Für mich ist die Neurowis-senschaft nicht nur ein Beruf, sondern eine Lebensphilosophie.
Wie ist die Beziehung zwischen dieser Wissenschaft und anderen Wissenschaf-ten wie Psychologie, Philosophie oder Soziologie?
Das ist eine sehr gute Frage. Natürlich erzählen Sie mir einerseits von verschiedenen Wissenschaften und andererseits haben Sie die Philosophie erwähnt, die auch spannend ist. Aber sie ist keine Wis-senschaft. Es sind verschiedene Arten, die Realität zu verstehen. Die Wissenschaft ist nicht der einzige Weg, das Leben zu in-terpretieren. Sie ist die Art und Weise, wie wir die Welt verstehen, indem wir sie auf wissenschaftliche Weise betrachten. Aus der Beobachtung, der Deduktion, entwickeln wir eine Hypothese, wir testen diese Hypothese, und daraus entwickeln wir eine Theorie. Die Philosophie kann auf andere Weise angegangen werden. Es stimmt zwar, dass in multidisziplinären Kontexten die Grenzen manchmal immer mehr verschwimmen. Andererseits gibt es Berührungspunkte zwischen Psychologie, Soziologie und den Neurowissenschaften. Innerhalb der Psychologie arbeite ich in der Psychobiologie, die ein Teil der Neurowissenschaften ist. Alle diese Wissenschaften überschneiden sich. Aber nicht alles in der Psychologie ist Neurowissenschaft, es gibt verschie-dene Analyseebenen. In den Neurowis-senschaften gibt es einen Teil, der mehr damit zu tun hat, wie das Nervensystem ein bestimmtes Verhalten hervorbringt, aber es gibt auch einen Teil der Neuro-wissenschaften, der molekularer, zellulä-rer und grundlegender ist. Ausgehend von den Ionenkanälen kann man auf ver-schiedenen Analyseebenen untersuchen, wie Gewebe und Systeme organisiert sind, wie Menschen funktionieren, wie sie denken können, aber auch, wie sie mitei-nander in Beziehung treten können. Da-mit würden wir mehr in den Bereich der sozialen Neurobiologie vordringen.
Vor welchen Herausforderungen steht die Neurowissenschaft?
(Sie lacht.) Vor vielen. Natürlich müssen wir im Vergleich zu anderen Wissenschaf-ten, die schwieriger sind, noch eine Men-ge verstehen. Wir benutzen unser eige-nes Gehirn, um unser Gehirn zu verste-hen. Das ist schon eine Herausforderung. Einerseits muss die Neurowissenschaft mehr über die normale Funktionsweise des Nervensystems herausfinden und sich nicht nur auf die Pathologie konzentrie-ren. Im Bereich der Pathologie wurden zwar viele Anstrengungen unternommen, um mehr über neurologische Probleme zu erfahren, etwa bei sensorischen, mo-torischen oder kognitiven Systemen. Aber in allen Bereichen der psychischen Ge-sundheit hinkt die Neurowissenschaft noch hinterher. Wir müssen noch mehr verstehen. Das ist logisch, denn eine psy-chiatrische Störung ist viel komplexer als eine sehr spezifische neurologische Er-krankung. Bei psychischen Problemen wirken sehr viele Gene zusammen, die in Beziehung zueinander und zur Umwelt stehen. Eine Herausforderung für die Neurowissenschaften besteht sicherlich darin, psychische Krankheiten zu verste-hen.
Viele Wissenschaftler hoffen, dass die Neurowissenschaften Lösungen für die Alzheimer-Krankheit entwickeln können.
Ich bin kein Experte auf diesem Gebiet. Aber es ist eine der Krankheiten, bei denen wir bereits viel Wissen angesam-melt haben. Wir kennen zumindest einen Teil der biochemischen Kette von Ereig-nissen, die dabei ablaufen. Aber es ist schwierig, kurzfristig an eine “Heilung” zu denken. Bei der Alzheimer-Krankheit wirken mehrere Ursachen, genetische Aspekte und Lebensgewohn-heiten zusammen. Wahrscheinlich gibt es kein einzelnes “Mittel” gegen diese Krankheit. Auf der anderen Seite gibt es den “Egois-mus” der westlichen Gesellschaft. In an-deren Entwicklungsländern stellt diese Krankheit kein Problem dar, weil die Menschen dieses Alter nicht erreichen. Wir sollten nicht vergessen, dass die sozi-ale, wirtschaftliche und gesundheitliche Belastung durch psychische Probleme viel größer ist als die Belastung durch neurodegenerative Krankheiten, für die mehr Mittel bereitgestellt werden als für die Erforschung psychischer Probleme. In den Neurowissenschaften geht es nicht nur um Neurodegeneration. Bei den meisten psychischen Erkrankungen gibt es keine Neurodegeneration. Es handelt sich um eine subtile Funktionsstörung von Schaltkreisen.
Sie haben die Auswirkungen von Stress auf das Verhalten erforscht. Erzählen Sie uns davon.
In meiner Forschungsgruppe beschäftigen wir uns seit vielen Jahren mit Stress, weil er einer der wichtigsten nicht-genetischen Faktoren ist, der für die meisten Psychopathologien prädisponiert. Er ist sozusagen ein transdiagnostischer Marker, der die Anfälligkeit erhöht. Stress ist eine Frage individueller Unterschiede, was für Sie stressig sein mag, ist für mich nicht stressig. Es ist interessant, die Aus-wirkungen auf die Gesundheit zu unter-suchen. Stress an sich ist keine Krankheit, bestimmte Stressniveaus sind adaptiv. Wenn Stress im Laufe der Evolution der Arten aufrechterhalten wurde, dann deshalb, weil Stress aktiviert, Ressourcen mobilisiert und auf Handlungen vorberei-tet. Problematisch wird es, wenn der Stress anhaltend, chronisch ist.
LasTop100: 2019 wurden Sie zu einer der 10 besten Frauen unter den 100 besten Akademikern Spaniens ernannt.
Es ist eine Auszeichnung, die die Aktivitä-ten von Frauen in der Wissenschaft und in vielen anderen Bereichen sichtbarer machen soll. Man muss von einem Ver-band und einem Forschungszentrum nominiert werden. Es gibt Tausende von sehr talentierten Frauen. Ich war begeis-tert von der Sichtbarkeit meiner For-schung am Institut und an der Fakultät. Es stimmt zwar, dass wir Frauen in vielen Labors arbeiten, aber es gibt nicht so viele Frauen in Entscheiderpositionen, als Leiterinnen von Projekten oder Professo-rinnen. Wie wir wissen, das es schwierig ist, das Berufsleben mit dem Familienle-ben zu vereinbaren. Die gläserne Decke ist da, und wir schaffen es nicht, sie zu überwinden.
Wie ist die Lage der Wissenschaftlerinnen in Spanien?
Das hängt vom Niveau ihrer wissenschaftlichen Laufbahn ab. Unter den Studierenden in den Bio-Fächern an der Universität gibt es mehr Frauen als Männer. Wenn sie dann promovieren, gibt es einen ers-ten Einschnitt. Wenn sie einen Postdoc machen, gibt es einen zweiten Einschnitt. Es gibt viel weniger europäische Projekt-leiter. Obwohl wir seit mindestens 20 Jahren dafür kämpfen, ist es für uns schwierig, die Kluft auszugleichen. Die Bildungsinhalte sollten von Grund auf geändert werden, aber nicht nur die Inhalte, sondern auch die Struktur der Bildung, d.h. die Struktur der Stundenplä-ne, der Schulorganisation. Die Familienor-ganisation ist schwer mit der Spitzenfor-schung zu vereinbaren. Es gibt aber ande-re Formen der Führung, in meinem Fall sind wir zwei Co-Principal Investigators mit einer eher horizontalen Forschungs-gruppe.
Was ist Ihr Ziel als Wissenschaftlerin?
Wir arbeiten derzeit mit Kindern. Wir untersuchen ihre Entwicklung, Risiko- und Schutzfaktoren im Zusammenhang mit der Anfälligkeit für die Entwicklung psychischer Probleme, insbesondere Verhaltensstörungen. Einer der Faktoren ist Stress. Wir haben im letzten Jahr damit begonnen, diese Risiko- und Schutzpfade zu untersuchen und herauszufinden, welche Faktoren damit verbunden sind, einschließlich psychosozialer und biologischer Variablen. Die Idee ist, die Verläufe zu verändern. Es handelt sich um ein Projekt an der Schnittstelle zwischen Neurowissenschaften, pädagogischer Psychologie und klinischer Psychologie.
Welches Land in Europa ist auf diesem Gebiet, den Neurowissenschaften, am weitesten fortgeschritten?Europa hat bescheidene Initiativen zur Zusammenarbeit, aber es sollten noch viel mehr entwickelt werden. Deutschland ist natürlich eines der führenden Länder. Früher hatten wir England, das jetzt etwas mehr außerhalb des europäischen For-schungsraums liegt, obwohl es immer noch an einigen Initiativen teilnehmen kann. Jetzt wird wahrscheinlich einer meiner Studenten für seine Dissertation einen internationalen Aufenthalt in einem deutschen Labor absolvieren. In Deutschland gibt es mehr Gruppen, mehr Vielfalt und mehr Budget.
Gibt es eine Zusammenarbeit mit Deutschland?
Es gibt Gruppen, die mit dem Max-Planck-Institut zusammengearbeitet haben. Auf dem Gebiet des Stresses forschen viele deutsche Universitäten. Es gibt staatliche Initiativen zur Förderung der Zusammen-arbeit. In diesem Herbst hat das Ministe-rium zum Beispiel einen Aufruf zur Zu-sammenarbeit zwischen Deutschland und Spanien im Bereich der Psychologie ge-startet.
Man sagt, dass Katalonien eine große wissenschaftliche Struktur hat.
Das stimmt, auch wenn meiner Meinung nach zu viele Ressourcen in Spitzenforschungszentren fließen, die keine Lehre betreiben. Die Universitäten werden vernachlässigt, denn wir sind diejenigen, die tagtäglich für die Ausbildung der For-scher verantwortlich sind. Ich glaube, man macht einen strategischen Fehler, wenn man so sehr auf Exzellenz setzt ohne da-ran zu denken, dass wir einen Pool von Forschern schaffen müssen. Exzellenz kommt nicht wie ein Churro daher. Sie entsteht durch die Unterstützung von Gruppen, die sich auch der Ausbildung widmen. Das fehlt hierzulande; in ande-ren europäischen Ländern wird das nicht so gemacht. Wir haben einen langen Weg vor uns.
In Ihrem Roman „Beyond My Kingdom“ erzählt Yaa Gyasi die Geschichte einer jungen Neurowissenschaftlerin in den USA. Steht die Wissenschaft im Wider-spruch zur Religion oder ergänzen sie sich?
Diese Frage finde ich interessant. Ich habe es noch nicht gelesen.
Wer finanziert die Forschung und profitiert sie von Spenden aus der privaten Gesellschaft?
In Katalonien sind es vor allem die Gene-ralitat und das Ministerium. Es gibt Aus-schreibungen für bestimmte Projekte. Die Finanzierung ist projektabhängig, eine Grundfinanzierung gibt es in der Regel nicht. Man muss nach Projekten auf spa-nischer oder europäischer Ebene suchen. In anderen Ländern gibt es eine Grundfi-nanzierung, und man beantragt zusätzli-che Projekte. Es gibt nicht viele Stiftun-gen, die Forschung finanzieren. Wir hat-ten das Glück, von der Alicia-Koplowitz-Stiftung ein Projekt zur psychischen Ge-sundheit zu erhalten und ein weiteres von der Marató de TV3, einer Initiative, die Geld für Solidarität sammelt.
So wie Sie es beschreiben, sind Sie nicht nur in Forschung und Lehre involviert, sondern auch in administrative Aufgaben zur Beschaffung von Mitteln.
Ein großer Teil meiner Zeit ist das: Büro-kratie. Abgesehen davon stehen wir zunehmend unter Druck, alles Mögliche zu tun. In letzter Zeit besteht man auch da-rauf, dass wir uns in der Gesellschaft en-gagieren. Ich liebe das, aber all das kostet viel Zeit.
Wenn Sie mit Spendern in Kontakt treten, appellieren Sie dann an ihren Verstand oder an ihr Herz?
Es hat bei uns wenig Tradition, Geld von privaten Einrichtungen einzuwerben. Die beiden Stiftungen, von denen ich gespro-chen habe, sind Wettbewerbsprojekte, die wir bekommen haben.
Männer schlagen Alarm wegen Diskrimi-nierung und erhalten Unterstützung von des CIS (Centro de Investigaciones Soci-ológicas). Bringt Sie das zum Lachen oder zum Nachdenken?
Es bringt einen zum Lachen. Ich denke, die Wahrheit ist, dass wir Frauen in vielen Bereichen immer noch diskriminiert wer-den. Ich halte positive Diskriminierung für eine gute Sache. Die Parität geht manch-mal auf Kosten der wenigen Frauen in Entscheidungspositionen.
Vielen Dank für das anregende Gespräch.
Von Ina Laiadhi, Januar 2024
Infos

Schlagwörter: Gesundheit, Interviews, Moderne Welt

 Share On Facebook
Share On Facebook Tweet It
Tweet It