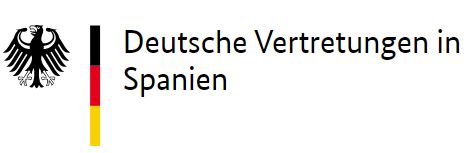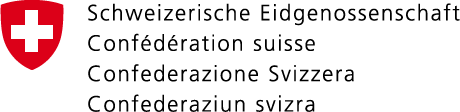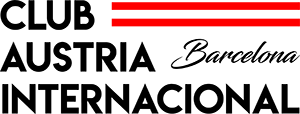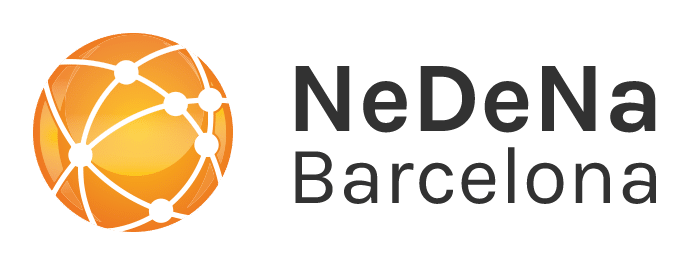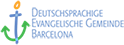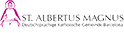Schreiben wie Natalia Ginzburg

Ich treffe Jenn Díaz in einer Hotelhalle im Zentrum von Barcelona, wo zahlreiche Touristen in tiefen Ledersesseln Zuflucht vor der Hitze und dem Großstadtgetümmel gesucht haben. Die junge Autorin wurde schon mit der großen Ana Maria Matute verglichen.
Sie haben sehr jung angefangen zu schreiben. Ist Ihnen das Schreiben zugeflogen oder sind Sie zum Schreiben gegangen?
Ich würde sagen, das Schreiben ist zu mir gekommen, eher als andersherum. Zunächst wollte ich Sportlehrerin werden. Aber mit 18 verlor ich das Interesse am Sport, ich trainierte nicht mehr regelmäßig. Ich begann dann ein Philologie-Studium, ohne dass ich eine große Leserin gewesen wäre. In der Schule las ich gerade mal die Schullektüre. Auch bei mir zuhause las niemand, es gab keine Bücher. Die Fächer Katalanisch und Spanisch waren mir aber immer leicht gefallen. Ich schrieb kleine Geschichten für meinen Blog, was damals gerade in Mode kam und erhielt viel positives Feedback. Im Studium stieß ich auf Carmen Martin Gaité und war so begeistert, dass ich ihre Werke in einem Sommer in einem Rutsch las. Ich erinnerte mich, dass ich schon als Kind viel aufgeschrieben hatte, weil mir das einfacher schien, als etwas zu sagen. Und so fing ich an zu schreiben. Durch Zufall lernte ich einen Verleger kennen, den mein erster Roman interessierte und der mir einen Vertrag anbot. Das lief alles ganz leicht.
Ist Schreiben für Sie eine Pflicht oder ein Vergnügen?
Für mich ist Schreiben jetzt weder Pflicht noch Vergnügen, es ist mein Beruf. Ich lebe vom Schreiben: Kolumnen in Jot.Down oder Artikel für anderen Medien. Schreiben ist meine Lebensmethode und verhilft mir zu wirtschaftlicher Unabhängigkeit. Zu Anfang lag es zwischen Vergnügen und Notwendigkeit, war aber niemals eine Pflicht. Das Romanschreiben hat nichts damit zu tun. Wenn man in diesem Kreis arbeitet, stellt man sich diese Frage nicht mehr. Man schreibt seine Geschichten und weiß, dass man verlegt wird, dass es Leser geben wird. Alle literarischen Ideen konzipiert man praktisch schon als Bücher. Alles, was ich erlebe, klassifiziere ich sofort: das passt in eine Geschichte, das in einen Roman, das kann einer Figur passieren. Ich sammle das alles. Mein Idealzustand wäre auf jeden Fall, nur noch Romane zu schreiben, das heißt davon leben zu können. Das ist aber noch nicht möglich.
Die Frau spielt in Ihrem Werk eine wichtige Rolle. Aber letztlich weiß man nicht, ob sie Frauen oder Männer glorifizieren. (In zwei Romanen stirbt anfangs der Mann im Haus. Müssen die Männer erst sterben, bevor die Frauen auf die Bühne treten können?)
Die Männer natürlich. Sie lacht lauthals. Meine Figuren sind immer Frauen. Sie sind schwach, deshalb denkt man, dass die Männer, die vorkommen stark sein müssen. Das sind sie aber nicht. Die Leser beschweren sich: Entweder sind sie böse oder ich bringe sie um oder sie haben nur in einer Nebenrolle. Es scheint, dass ich sie schlecht behandele, aber das stimmt nicht. Ich behandele sie gar nicht. Mich interessieren Frauen. Alle anderen sind nebensächlich. Ich betrachte die Welt mit den Augen einer Frau. Meine Protagonistinnen sind nicht perfekt, sie sind keine Heldinnen, sie bergen Schwächen und Widersprüche. Ich gebe ihnen mehr Raum, bin aber auch gleichzeitig wesentlich fordernder zu ihnen.
Wie ist Ihre Beziehung zur ländlichen Welt?
Ich bin in Sant Feliu de Llobregat aufgewachsen, bei Barcelona. In meinem Viertel lebten damals 90% Andalusier und Extremeños und 10% Katalanen. Ich lebte in einem sehr urbanen Umfeld, aber jeden Sommer habe ich im Dorf meiner Großeltern in der Extremadura verbracht, wo das Ländliche eine sehr wichtige Rolle spielt. Natürlich hatte das in den 90er Jahren nichts mit dem kargen Landleben gemein, wie meine Großeltern es erlebt hatten. Aber ich lebte eine Freiheit auf dem Lande, geduscht wurde mit dem Schlauch, es gab überall Haustiere, Hühner, Schweine. Das war alles sehr natürlich. Und als ich Carmen Martin Gaité gelesen hatte, erschien mir das Dorf meiner Großeltern plötzlich als literarischer Stoff. Alle diese kleine Geschichten, die ich erlebt hatte, waren sehr reich und sehr poetisch. Meine ersten Romane sind deshalb in diesem Umfeld angesiedelt. Es ist eine domestizierte Ländlicheit, dieser Neoruralismo, wie wir ihn auch in „Das Alte Land“ von Dörte Hansen finden. Mich zieht das Landleben sehr an.
Sie haben für die Erzählungen „Vida Familiar“ den Premio Mercè Rodoreda erhalten. Kann man nach dem Roman „Plaza Diamante“ von Mercè Rodoreda, noch einen weiteren Roman über die Stadt Barcelona schreiben?
Nach Mercè Rodoreda kann man sowieso über nichts mehr schreiben. Sie lacht. Sie hat nicht nur die Radiographie einer Stadt, sondern auch der Frau, des Konflikts und des Dramas der Familien geschrieben. Und das mit einer solcher Meisterschaft der Sprache, der Zeit, der Intimität. Das ist eine umfassende Literatur, der nichts fehlt. Sie ist sicherlich unsere universalste, katalanische Schriftstellerin. Es gibt aber jetzt ein anderes Barcelona, über das jemand schreiben könnte. Es wird jedoch noch 100 Jahre dauern, bis wieder jemand wie Mercè Rodoreda schreibt.
Ebenso wie die portugiesische Malerin Paula Rego, der eine Ausstellung im Virreina gewidmet war, hat Sie die italienische Schriftstellerin Natalia Ginzburg stark inspiriert.
Ich wäre gern Natalia Ginzburg. Sie erzählt von der Alltäglichkeit, der Familie, den Dramen, die sich abspielen. Es geht scheinbar um Kleinigkeiten, aber sie schafft es, ihnen einen universalen, literarischen Wert zu geben. Sie macht es auf auf eine elegante, kultivierte Art. Sie hat Frauen in ihrem häuslichen Umfeld dargestellt und zwar vor dem historischen Hintergrund des Krieges und des Faschismus. Zum Beispiel in „Valentino“ konstruiert sie die Hauptfigur in ihrem Leiden. Der Leser leidet intuitiv mit, aber man erfährt man erst am Schluss, an welchem gesellschaftlichen Stigma Valentino wirklich leidet.
Welche Rolle spielt die Literaturkritik in Spanien? Haben Sie als junge Autorin darunter gelitten?
Um ehrlich zu sein, die Literaturkritik hat mich entweder ignoriert oder gut behandelt. Wenn man etwas schreibt, gibt es widersprüchliche Etappen: Man denkt, man hat etwas wunderbares geschrieben, dann hält man es für nichtig, dann meint man, man hat die Welt umarmt, dann hält man es für unbedeutend, denn es ist nur die eigene Geschichte, die so individuell ist, dass sich niemand dafür interessiert. Und dann kommt die Kritik. Wenn sie sagt: „Sehr gut!“, ist man natürlich glücklich. Das Verlagshaus ist glücklich, weil das mehr Verkauf, mehr Leser verspricht. Aber wenn man viele Leser hat, ist die Kritik weniger wichtig. Natürlich trägt sie dazu bei, dass man bekannter wird. In vielen Interviews geht es auch weniger darum, sich intensiv mit dem Werk auseinanderzusetzen, als darum den Inhalt und ein paar Ideen des Autors zu erläutern. Richtige Literaturkritik gibt es immer weniger.
Sie haben im März die spanische Übersetzung des Buches „Altes Land“ von Dörte Hansen im Interview mit der Autorin im Goethe-Institut vorgestellt. Wie ist Ihre Beziehung zur deutschen Literatur?
Ich habe bisher wenige deutsche Autoren gelesen. Wenn ich ein Buch gelesen habe und es gefällt mir gut, dann interessiere ich mich erst hinterher mehr dafür, wer der Autor ist, wo er her kommt. Begeistert hat mich das Buch von Angelika Schrobsdorff „Du bist nicht so wie andere Mütter“.
Der Roman von Dörte Hansen hat viel mit meinem Werk gemeinsam. Es geht bei ihr um die Familie, die Rolle der Frau in der Gesellschaft und das Leben auf dem Land. Bei ihr trennt sich die Hauptfigur und muss sich allein um die Erziehung ihres Sohnes kümmern. In meinem Roman „Madre e Hija“ geht es um die besondere Beziehung zwischen Mutter und Tochter. Aber wir können noch einen Schritt weitergehen. Ich bin hier in einer Bewegung engagiert, die sich für die gesellschaftliche Aufwertung sogenannter Patchwork-Familien einsetzt. „Reconstituidas“ auf Spanisch, was mir aber nicht gefällt, weil wir nichts Altes wieder zusammenbringen, sondern etwas
Neues schaffen. Die negativ besetzte Figur der Stiefmutter – ich bin auch eine madrastra – interessiert mich sehr. Die Kinder leben häufig in einem Loyalitätskonflikt, da sie glauben, sie verraten ihre Eltern, wenn sie zu den neuen Familienmitgliedern positive Gefühle aufbauen. Mutterschaft und Vaterschaft wird häufig als etwas Privates angesehen, aber eigentlich sollte es mehr in die öffentliche und politische Debatte eingehen. Wir müssen umdenken und die neuen Gegebenheiten anders bewerten. In den Märchen war die Böse ursprünglich die Mutter, aber in den Grimmischen Märchen wurde daraus die böse Stiefmutter, die bei Disney dann sehr stilisiert wurde. Die Linguistin Berta Rubio zum Beispiel versucht mit ihrem Projekt Vadepapus neue Termini einzuführen, um die negativ besetzten fallen lassen zu können.
Fühlen Sie sich als Katalanin, Spanierin oder Europäerin?
Ich fühle mich Katalanin, Spanierin und Europäerin. Mehr Katalanin als Spanierin, mehr Katalanin als Europäerin, mehr Europäerin als Spanierin. Sie lacht laut. Ich habe ein katalanisches Bewusstsein, auch wenn der Großteil meiner Familie aus Extremadura und Andalusien kommt. Bei mir zu Hause wurde degegen mehr Extremadurisch und Spanisch gesprochen. Aber ich bin hier groß geworden, mit katalanischer Sprache, Kultur und Sinn für Humor. Es gibt hier viele prägende Eigenheiten wie in Andalusien und im Baskenland auch. Ich fühle mich zu der hiesigen Ideenwelt, dem Gedankengut, dem Empfindungsvermögen und der Sprache zugehörig.
Europa hilft uns Schriftstellern sehr wenig. Vielleicht eher schon in der Musik oder im Kino. Was die Literatur anbelangt, ist Europa keine Einheit. Mir fehlen Übersetzungen aus dem Deutschen.
Katalonien erlebt ein Aufbrodeln um die Unabhängigkeit. Wie stehen Sie dazu?
Noch vor zehn Jahren konnten die Unabhängigkeitsbefürworter sich nicht laut äußern. Heute dagegen gibt es auch viele Unabhängigkeitsbefürworter ohne Berufung. Ich persönlich bin eher für einen Föderalismus, aber geneigt zum Si. Wenn nationale Wahlen sind, werde ich radikaler, weil ich mir sage, dass ich das nicht bin. Ich bin dafür, das Gesundheitswesen, die Kultur, die Erziehung, das Soziale zu stärken. Das ist wichtiger als die Unabhängigkeit.
Wenn man den Umfang Ihrer literarischen und journalistischen Produktion anschaut, haben Sie noch Zeit zum Leben?
Ja, natürlich. Was ich „Leben“ nenne, liegt in den Alltäglichkeiten, die ich genieße. Mein Garten zum Beispiel. Ich schreibe zudem sehr schnell. Ich verbringe nicht sehr viele Stunden am Schreibtisch, so dass ich für andere Dinge noch Zeit habe. Ich würde gern viel mehr reisen, um die Welt oder mein Land kennenzulernen, aber dazu reichen meine Einkünfte noch nicht. Wir haben unsere Prioritäten auf Familie und ein großes Haus gelegt. Aber als ich meinen Mann zu einer Messe nach Friedrichshafen begleitete habe, war ich begeistert von der wunderbaren Landschaft dort.
Sie haben einmal gesagt, dass Sie weinen, wenn Barça verliert. Wenn Barça gewinnt, schreiben Sie dann?
Ich schimpfe! Ich werde dann verrückt. Besonders wenn es schwierig war. Ich habe dann so viel Andrenalin, dass es einfach irgendwie raus muss. Neulich habe ich ein Interview im Stadion gemacht. Das war genial, ich war wie ein Guiri.
Unter uns Journalisten: Können Sie uns den Plot Ihres neuen Romans verraten?
Vor drei Jahren habe ich mit einer Freundin den Camino Santiago – Finisterra gemacht, la Finisterrana, der bis zum Meer geht. Mein nächster Roman ist dort angesiedelt, ich hatte schon einige Figuren im Kopf und als ich diesen Weg gegangen bin, habe ich sie in diese Welt projiziert: die Erfahrung der Pilger, die Komplexität des Nomandenseins – wann stehen wir auf, was essen wir, bis wann müssen wir wo angekommen sein, wo halten wir, die Großzügikeit der Bewohner, der Ansporn, das Durchhalten. Eine eigene Welt. Ich will die Poesie dieses Weges herausarbeiten. Eine Frau trennt sich und beginnt einen neuen Weg. Ich werde den Roman gleichzeitig in Spanisch und Katalanisch schreiben, weil ich bei der Übersetzung von „Madre e hija“ festgestellt habe, dass ich durch das Übersetzen ein zusätzliches Verständnis bekomme und das will ich gleich in den Roman integrieren.
Jenn Díaz, wir danken für das sehr anregende Gespräch.
Von Ina Laiadhi und Kati Niermann
Schlagwörter: Europa, Frauen, Interviews, Literatur

 Share On Facebook
Share On Facebook Tweet It
Tweet It