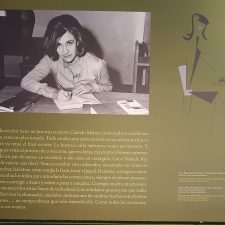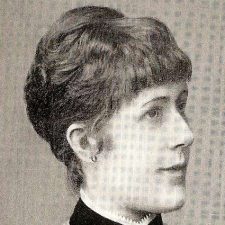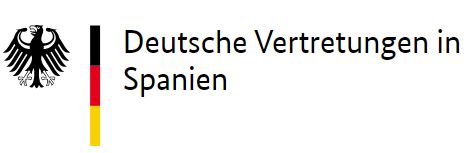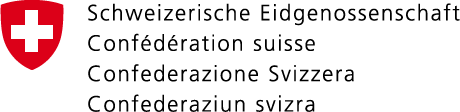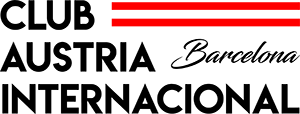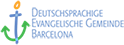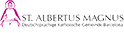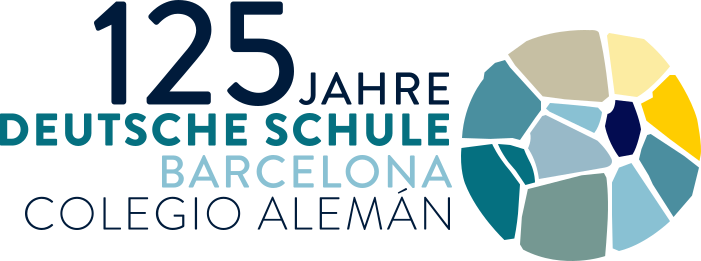Lisa Fittko– Über die Pyrenäen ins Exil

Buchtipp Mein Weg über die Pyrenäen
Wer ist Lisa Fittko? Diese außergewöhnlich tapfere, solidarische und unerschrockene Frau half – zusammen mit ihrem Mann Hans Fittko – vielen von den Nazis Verfolgten, Künstlern, Schriftstellern wie z.B. Heinrich Mann und Ehefrau und Philosophen wie Walter Benjamin auf dem Weg ins Exil und in die Freiheit.
Wie kam es zur aktiven Fluchthilfe? Das im 2. Weltkrieg von Varian Fry geleitete amerikanische Hilfswerk Emergency Rescue Committee in Marseille engagierte bergkundige Fluchthelfer, um die Flüchtenden über den früheren Schmugglerpfad – die Route Lister – in das damals neutrale Spanien zu begleiten. Der Name des Bergpfads stammt von General Enrique Lister, der 1939 mit einem Teil der republikanischen Armee und Überlebenden des Spanischen Bürgerkrieges an der Küste entlang aus Katalonien über die Pyrenäen nach Frankreich entkam. Die entgegengesetzte, nach den Fittkos als F-Route bezeichnete Strecke wird seit der Einweihung des Bergweges vom französischen Banyuls über die Pyrenäen zum katalanischen Portbou 2007 auch Chemin Walter Benjamin genannt. Alljährlich organisiert das Ajuntament Portbou eine Gedächtnis-Wanderung am 26. September (Walter Benjamins Todestag).
Walter Benjamin ist der erste Emigrant, den Lisa Fittko über den Bergpfad nach Spanien begleitet. Benjamin, der mit Hans Fittko im Lager Vernuche interniert gewesen und nach Marseille geflohen war, bittet Fittko in Port-Vendres ihn am 25. September 1940 über die französische Grenze nach Spanien zu geleiten. Lisa Fittkos eindrucksvolle Beschreibung ihrer Testüberquerung der Pyrenäen mit Walter Benjamin (Kapitel 7) aus ihrem 1. Erinnerungsbuch, hat Geschichte gemacht. Tragisch ist nämlich der Umstand, dass die Flucht Walter Benjamins die einzige ist, die einen tödlichen Ausgang nahm. Vom verlorenen Manuskript Benjamins erfährt Fittko Jahre später, denn sie musste sich von der kleinen Gruppe um Walter Benjamin kurz hinter der spanischen Grenze trennen. Die von Benjamin wie ein Schatz gehütete Aktentasche mit den Papieren hatte Lisa stets in Sicherheit gewähnt.
Im April 1941 folgen die Fittkos der Familie nach Cassis und müssen in Erwartung eines Ausreisevisums die „Grenzstation“ des ERC in Banyuls verlassen. Zudem war die Situation für humanitäre Hilfsorganisationen äußerst gefährlich. Varian Fry wurde kurz darauf als pro-jüdisch und anti-nazistisch verhaftet. Später schrieb er seine Erinnerungen an die Ereignisse zur Zeit des ERC in seinem Buch Surrender on Demand nieder.
Lisa Fittko (Elizabeth Ekstein) wird 1909 in Uzgohrod (Ukraine, damals am Rand der österreichisch-ungarischen Doppelmonarchie) innerhalb einer deutschsprachigen jüdischen Familie geboren. In Wien ist ihr Vater Mitherausgeber der Antikriegszeitung Die Wage und bis 1920 deren Eigentümer. 1922 siedelt die Familie nach Berlin über. In Wien hatte sich Lisa den Pfadfindern angeschlossen, in Berlin dem Sozialistischen Schülerbund. Überzeugt von freiheitlichen Idealen stürzt sie sich in Demonstrationen und Straßenschlachten. Als die SA den Druck auf politische Gegner weiter verschärft, muss Lisa Fittko untertauchen. Jahrelang lebt sie in Verstecken und illegalen Schlupflöchern, bis sie als 24-Jährige über die tschechische Grenze nach Prag zu ihren Eltern flieht. Dort lebt sie weiterhin im Untergrund und lernt in Widerstandsgruppen ihren Mann kennen. Johannes Fittko stammt aus Spandau, ist politischer Aktivist und Journalist und schleust Flüchtlinge über die tschechische Grenze. Von nun an macht das Paar gemeinsame Sache, zuerst in der Tschechoslowakei, dann in Frankreich.
Lisa Fittkos erstes Buch „Mein Weg über die Pyrenäen“ wurde 1985 vom Hanser Verlag veröffentlicht. Viele Publizisten interessierten sich für die Lebensgeschichte Lisa Fittkos wie die Bühnenbildnerin und der Regisseur Hanne und Hubert Eckart. Ihr 2001 mit Lisa Fittko geführtes Interview gaben sie 2006 als Hörbuch heraus. Hierin erzählt die 92-jährige Lisa Fittko aus ihrem ereignisreichen Leben, von ihrem Durchhaltevermögen, ihrer Angst und Verzweiflung, ihren politischen Zielen und ihrem aktiven Widerstand.
Fittkos autobiographisches Werk als politische Aktivistin und sozialistische Schriftstellerin ist spannend geschrieben. Ihr ungebrochener Widerstand und ihre aktiven Fluchthilfeaktionen sind beispielhaft. Sie träumte nicht nur ihre sozialistischen Ideale, sondern setzte sie in die Tat um. Fittkos Solidarität kam jedem notleidenden Menschen zugute, ungeachtet seines Ranges. Das auf dem Denkmal des israelischen Künstlers Danny Karavan in Portbou eingravierte Zitat Walter Benjamins drückt dies aus: „Schwerer ist es, das Gedächtnis der Namenlosen zu ehren als das der Berühmten“. Lisa Fittko hat mit ihrem Lebensweg bewiesen, dass sie schwere Wege gegangen ist. Ihre Geschichte bietet allen Generationen ein nachahmenswertes Vorbild. Hans Fittko wurde ebenfalls posthum geehrt: Für dessen jahrelange Widerstandstätigkeit nahm seine Witwe 2000 stellvertretenderweise die jüdische Yad-Vashem-Medaille und Ehrenurkunde für die Gerechten unter den Völkern entgegen.
Von Dr. Evelyn Patz Sievers
Schlagwörter: Biografisches, Frauen, Literatur

 Share On Facebook
Share On Facebook Tweet It
Tweet It